Der Baron Bagge (1936)
Novelle
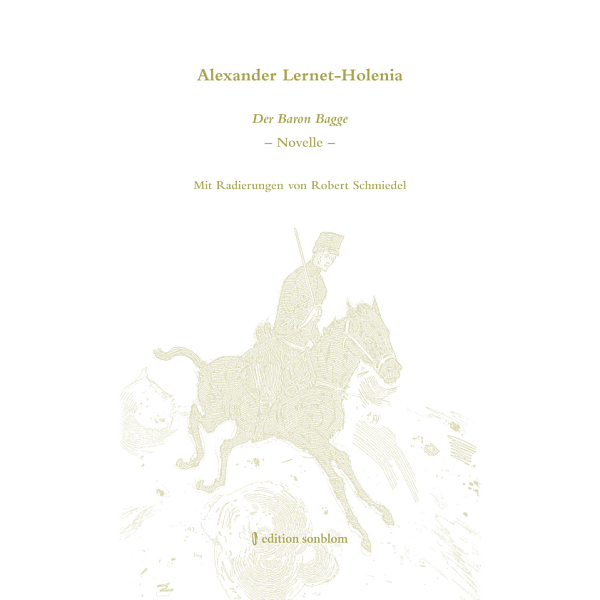
Nachwort von Franziska Mayer
In: Der Baron Bagge, Edition Sonblom 2014, S. 66-69.
Alexander Lernet-Holenias Novelle Der Baron Bagge von 1936 ist einer jener Texte über den Ersten Weltkrieg, die den Fokus weniger auf den Krieg selbst als auf das Leben der Kriegsheimkehrer nach 1918 legen. Wie Joseph Roths Flucht ohne Ende (1927) und Leo Perutz' Wohin rollst du, Apfelchen ... (1928) schildert er die Schwierigkeiten der Soldaten, sich in eine Nachkriegsgesellschaft zu integrieren, die sich im Falle Österreichs fundamental von jener Gesellschaft vor dem Krieg unterscheidet.
Der Österreicher Lernet-Holenia (1897-1976) oder Alexander Lernet, wie er damals noch hieß, hatte sich 1915 selbst als Einjährig-Freiwilliger bei den Dragonern gemeldet und von 1916 bis 1918 im Osten am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Ähnlich wie bei seinem Kollegen Heimito von Doderer war das Kriegserlebnis die Initialzündung für sein Schreiben, doch begann der in Kärnten und Wien aufgewachsene Lernet zunächst mit Lyrik in der Rilke- und Hofmannsthal-Nachfolge. Von seinen Vorbildern ermuntert und gefördert, erschien 1921 sein erster Gedichtband Pastorale in einem bibliophilen Kleinverlag in Wien. Erfolge feierte der junge Dichter, der sich nach der Adoption durch
die Familie seiner Mutter inzwischen Lernet-Holenia nannte, in den Zwanzigerjahren vor allem als Bühnenautor. 1926 erhielt er für zwei Komödien, Ollapotrida und Österreichische Komödie, den renommierten Kleist-Preis. Seit diesem Jahr wohnte er in einer Villa seiner Mutter am Wolfgangsee, unter prominenten Künstlern eine beliebte Sommerfrische. Hier verkehrte er mit Leo Perutz und Stefan Zweig sowie mit den aus NS-Deutschland emigrierten Ödön von Horváth und Carl Zuckmayer. 1930 erschien der erste Roman, und zwar in Berlin bei S. Fischer, der bis 1945 sein wichtigster Verlag blieb. In schneller Folge publizierte Lernet-Holenia bis 1938 vierzehn Erzählbände und Romane, von denen drei verfilmt wurden: Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen, Ich war Jack Mortimer und Die Standarte.
Schon der letztgenannte Roman hatte 1934 die Desillusionierung eines österreichischen Fähnrichs durch den Zusammenbruch der Monarchie und den Zerfall des Habsburgerreiches ins Zentrum einer gerahmten Rückblickserzählung gestellt, schon hier zerstört die Bindung an die alten militärischen Werte, repräsentiert durch die titelgebende Standarte, das Leben der jungen Männer. Zwei Jahre später griff die Novelle Der Baron Bagge erneut das Kriegsheimkehrerproblem auf, wenn auch in
beiden Fällen der weitaus größte Teil der Handlung im Krieg selbst spielt. Und noch mitten im Zweiten Weltkrieg, 1942, widmete sich der Autor dem Thema erneut in Beide Sizilien, wo eine Mordserie unter Offizieren des im Titel genannten Regiments das Sterben in die Zwischenkriegszeit hinein verlängert.
Im Unterschied zu berühmten Weltkriegsromanen wie Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues (1929) erscheint der Krieg bei Lernet-Holenia nicht als entmenschlichte Materialschlacht. Vielmehr lässt das Agieren von Kavalleriepatrouillen in zum Teil noch glänzend-bunten Vorkriegsuniformen durchaus Spielraum für individuelles Handeln und Entscheiden. Gemeinsam ist den Kriegstexten des Autors der Verfall militärischer, politischer und moralischer Werte, der den Zerfall des Vielvölkerstaates vorwegnimmt.
Doch ist es im Baron Bagge nicht so sehr die Distanz zwischen den „slawischen Bauerngesichter[n]" der Mannschaft und dem kosmopolitischen Habitus der Offiziere - sogar ein Amerikaner aus Kentucky hat sich aus nicht näher erläuterten Gründen der österreichischen Armee angeschlossen, freilich noch vor Kriegseintritt seines Landes, wie der Erzähler klarstellt -, die zur Katastrophe führt, sondern das eigenmächtig- selbstmörderische Agieren des Befehlshabers Semler, der seine Schwadron in ein mörderisches Gefecht gegen russische Truppen schickt. Immer wieder betont Bagge, dass sich der Rittmeister nicht an das Reglement für Aufklärungspatrouillen hält, sondern fast besessen und gegen den Rat seiner Offiziere sich selbst und die ihm Anvertrauten in die Vernichtung treibt. Es ist hier also die (militärische) Führung, die jene finale Katastrophe auslöst, die stellvertretend für das Ende des ganzen Unternehmens Weltkrieg steht. Dem Ich-Erzähler, der, wie sich später herausstellt, als einer der wenigen das Gefecht überlebt, ist durch dieses Erlebnis eine Rückkehr in das zivile Leben verschlossen.
Der Selbstmord zweier Frauen und ein verhindertes Duell um eine dritte motivieren die Erzählung des Protagonisten, dessen Weltkriegserlebnisse sein abweichend-problematisches Verhältnis zu Frauen erklären sollen: „Denn ich war eigentlich schon verheiratet, und das kam so". Die folgende Binnenerzählung liefert schließlich die Erklärung für diese Aussage: In einer fantastischen Traumreise zwischen Leben und Tod war er jener Frau begegnet, die seine verstorbene Mutter ihm als Ehefrau zugedacht hatte, und hatte sie geheiratet. Als er aus dem Traum erwacht und erkennen muss, dass
Charlotte wie alle anderen Figuren, denen er nach dem Gefecht begegnet war, tot ist, ist er für alle erotischen Alternativen verloren; er wird geradezu zum uneinnehmbaren Objekt weiblicher Begierde, an dem mehrere Frauen tödlich scheitern.
Zentrales Motiv der Novelle ist die Brücke als Bestandteil der Topographie der realen oder geträumten Welt wie als mythischer Übergangsraum zwischen Leben und Tod. Gemeinsam ist diesen Brücken, dass sie vom Protagonisten nicht überschritten werden können. Stets bleibt er auf der Grenze, einem Zwischenreich zwischen Tod und Leben, aber auch zwischen der von der Mutter dominierten Jugend und dem Erwachsenenalter. Nur die erste Brücke über den Fluss Ondawa wird real erreicht. Hier kommt es zu jenem Gefecht, das Bagge beinahe als Einziger, verletzt und ohne Bewusstsein, überlebt. Die zweite - geträumte - Brücke über den San deutet der Erzähler zur letzten Etappe des nordisch-mythischen Helwegs um, den der gefallene Held in neun Tagen zurücklegt, bevor er endgültig den Todesraum erreicht. Im Traum kehrt Bagge hier als Einziger um. Doch es ist keine Rückkehr ins Leben. Vielmehr bleibt er in jenem Zwischenreich, in dem die Grenze zwischen Tod und Leben unbestimmbar ist.
In dem geträumten Raum, den er im Traum in neun Tagen durchquert, sind die Merkmale von Tod und Leben vertauscht: Die Natur wirkt tot und erloschen, die öde ungarische Kleinstadt wird zum übervölkerten vitalen Ausnahmeraum, in dem ständig gefeiert und getafelt wird. Dasselbe gilt auch für die Figuren: Die russischen Soldaten, von denen es in jener Gegend zu diesem Zeitpunkt wimmeln müsste, sind mysteriöserweise verschwunden; lebendiger und attraktiver als alle realen Frauen erscheint die tote Traumfrau Charlotte. Selbst nach dem Erwachen verwischt die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit ebenso wie jene zwischen Leben und Tod: „Zwischen den Träumen aber führten Brücken hin und wider, und wer könnte wirklich sagen, was Tod und was Leben sei oder wo der Raum und die Zeit zwischen beiden beginnen und wo sie enden!"
Zwar können die gescheiterte Reintegration in die Nachkriegsgesellschaft und das Festhalten an der Traumwelt als Kollateralschaden des verlorenen Krieges gelten, doch vermag Bagge dieses Scheitern durch seine eigene Darstellung zu seinen Gunsten umzudeuten. Stellvertretend hatte Charlotte das autoerotische Liebeskonzept des Protagonisten formuliert, der Liebe ausschließlich als Projektion eigener Wünsche denken kann: „Es gibt wohl keine wirklichen Beziehungen zwischen den Menschen. Es kann keine geben. Man ist einander immer nur ein Anlaß, sonst nichts." Und wie die erträumte Charlotte jeder realen Frau überlegen ist, so ist auch die geträumte Lebensgeschichte gegenüber der realen Biographie Bagges eindeutig im Vorteil. Ohne das erträumte Erlebnis auf der Brücke zwischen Leben und Tod bliebe ihm lediglich seine schwere Verwundung bei einem unsinnigen Gefecht in einem verlorenen Krieg eines mittlerweile zerfallenen Reiches. So aber fantasiert er sich selbst zum privilegierten Außenseiter, der als Einziger aus diesem Raum wieder zurückkehrt.
Dadurch gewinnt er dem sinnlosen Krieg letztlich doch noch einen individuellen Sinn ab, der freilich mit dem Krieg und seinem Ausgang wenig zu tun hat.
Die Unfähigkeit der Protagonisten in Lernet-Holenias Kriegsromanen und auch im Baron Bagge, mit der Realität nach dem Krieg und dem Ende der Monarchie zurechtzukommen, wird durch ihre fantastischen Erlebnisse, vor allem aber durch die nachträglichen Zuschreibungen eines höheren Sinns durch die Ich-Erzähler selbst kompensiert. Das wahre Leben spielt sich eben im Traum - oder besser noch: in der Literatur - ab.
München, im Mai 2014
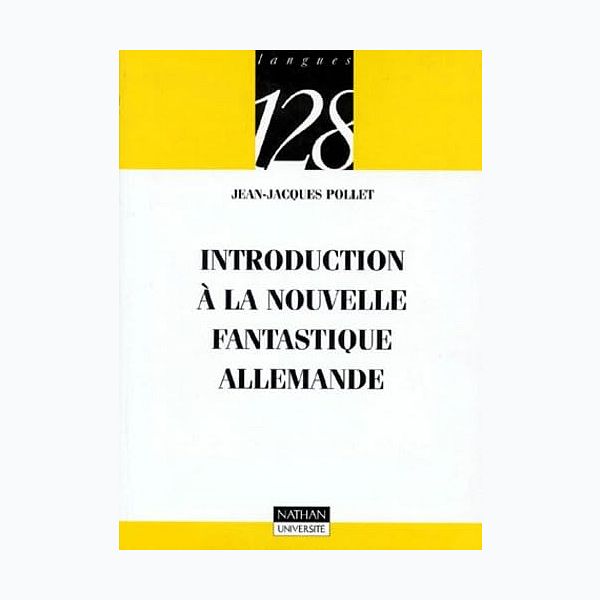
Alexander Lernet-Holenia ou le fantasme du passé
Jean-Jacques Pollet
In: Introduction à la nouvelle fantastique allemande. Paris: Edition Nathan 1997, S. 90-93.
Alexander Lernet-Holenia (1897-1976) ne saurait bien entendu être rattaché à la culture pragoise. Il n'y a pas plus viennois que cet aristocrate officier de cavalerie, né trop tard pour connaître la monarchie habsbourgeoise dans sa gloire. Il demeure cependant qu'une partie tout au moins de son oeuvre prolifique (romans et nouvelles, mais aussi pièces de théâtre et recueils lyriques) n'est pas sans parenté avec l'écriture perutzienne, parenté d'ailleurs signée par le fait qu' A. Lernet-Holenia relut et édita Le Judas de Léonard (Der Judas von Leonardo, 1959), le roman posthume de son ami Leo Perutz salué "comme un maître particulièrement vénéré".
La nouvelle intitulée Le Baron Bagge (Der Baron Bagge), publiée en 1936, est regardée à juste titre comme un paradigme de tout le fantastique holénien. Il s'agit d'un récit de guerre, comme d'ailleurs la plupart des grands romans de l'écrivain - L'Étendard (Die Standarte, 1934), Le Régiment des Deux-Siciles (Beide Sizilien, 1942), Mars en Bélier (Mars im Widder, 1941). Un certain baron Bagge, lieutenant de dragons, raconte comment au début de l'année 1915, sur les contreforts des Carpathes, son escadron essuya une attaque violente de l'armée russe, au passage d'un pont sur la rivière Ondawa. Mais Bagge, apparemment, sortit sain et sauf de l'affrontement, atteint simplement à la tempe par la projection d'une pierre. Lui et les survivants se replièrent sur la petite ville voisine de Nagy-Mihaly, que Bagge - étrange coïncidence -, connaissait par l'histoire de sa mère: celle-ci y avait en effet vécu deux ou trois ans du temps de son premier mariage, lorsque son mari commandait le régiment de l'endroit; elle fréquentait à l'époque la famille des Szent-Kiraly, dont la petite fille Charlotte lui paraissait être un très bon parti pour son fils. "Mais ensuite sa mère mourut et il oublia toutes ces choses. "A peine entré dans la ville, Bagge est reconnu par "une jeune femme grande, étonnamment mince, avec des yeux d'un bleu fantastique", qui n'est autre que Charlotte. Après quelques heures seulement, elle lui avoue son amour, lui confiant qu'elle sait tout de lui à travers ce que ses parents lui ont rapporté et qu'elle l'a en fait toujours attendu depuis l'enfance. La même nuit, elle se glisse dans sa chambre et s'offre à lui. Atmosphère étrange cependant: toute la contrée semble épargnée par la guerre, "l'absence totale des troupes russes étant complètement incompréhensible et laissant même une impression inquiétante". Bagge reçoit bientôt l'ordre de partir en reconnaissance avec quelques hommes pour repérer les positions de l'ennemi. Lorsque, au bout de deux jours de vaines recherches dans une campagne baignée de brouillard et apparemment désertée par toute la population, Bagge regagne la garnison, le commandant lui annonce que le régiment lève le camp dans les prochaines heures. Bagge court retrouver Charlotte à un bal masqué où toute la bonne société de la ville a été conviée. Saisis tous deux par de sombres pressentiments, ils décident de célébrer leur mariage sur le champ, en "une étrange et fantomatique cérémonie" qui réunit les invités de la mascarade. Bagge part avec "la certitude absolue qu'il ne reviendra jamais plus". Au bout de quatre jours de marche, le régiment s'apprête à passer un pont au milieu de fumées et dans un énorme fracas, "comme provoqué par de gigantesques chutes d'eau". Bagge, à cet instant, se réveille. Il se retrouve allongé, le front ensanglanté, au milieu du pont de l'Ondawa, pris sous la mitraille. Presque tous les hommes, autour de lui, ont été fauchés. Il comprend que, touché par une balle, il a en vérité perdu connaissance durant quelques secondes et que tout ce qu'il croit avoir vécu à Nagy-Mihaly n'était donc finalement qu'un rêve.
En quoi la relation du rêve, dans Le Baron Bagge, diffère-t-elle de la relation d'une expérience du même type dans le cadre d'un récit dit "réaliste", c'est-à-dire respectant rigoureusement les règles du vraisemblable? Dans ce dernier cas, le récit se doit d'installer, comme on sait, une différenciation explicite entre ce qui relève de la conscience vigile et ce qui appartient à l'expérience onirique. La reconnaissance de celle-ci s'opère, rappelons-le, sur des signes démarcatifs de la séquence narrative (entrée et sortie de songe, ex.: il s'assoupit/perdit connaissance - il se réveilla/sursauta, etc.), sur une syntaxe du récit (fonctionnement d'une logique événementielle n'obéissant pas nécessairement aux règles de la causalité), enfin sur le sémantisme même des événements narrés (qui transgressent éventuellement les normes de crédibilité et/ou de bienséance). Face à ce cahier des charges, Le Baron Bagge apparaît comme un récit qui tend à effacer au maximum les indices de différenciation de l'expérience onirique. Pas de signe démarcatif inaugural, des événements qui s'enchaînent suivant une rigoureuse logique causale (la rencontre, le mariage avec Charlotte s'inscrivant parfaitement dans l'histoire antérieure), enfin aucun élément qui puisse être qualifié à proprement parler d'invraisemblable, si ce n'est la disparition inexpliquée des troupes ennemies. Pour attester du caractère onirique de l'aventure, il ne reste en définitive que le signe démarcatif final du réveil. Mais sans celui-ci, il n'y aurait dans la chronologie de l'épisode lui-même que quelques vagues notations d'atmosphère, quelques détails curieux - comme par exemple le fait que Bagge, le premier soir, n'arrive pas à s'expliquer comment Charlotte a pu rentrer dans sa chambre alors que la porte était fermée à clef de l'intérieur et que la clef, de surcroît, était restée dans la serrure -, mais qui, à vrai dire, n'apparaissent véritablement signifiants que rétrospectivement. En fait, le texte tisse une rigoureuse continuité entre le début du récit, qui relève de la sphère de l'histoire réelle perçue par une conscience vigile, et l'aventure onirique ellernême. Si bien que s'opère une sorte de chiasme qui croise les catégories du rêve et de la réalité: "Au fond de moi-même, note finalement Bagge, ce rêve demeure réalité tandis que la réalité ne m'apparaît plus que comme un rêve."
Pour ce qui est du contenu même du rêve de Bagge, on peut dire qu'il exhibe une signification fantasmatique primaire correspondant tout à fait à la description freudienne du fantasme comme "scénario imaginaire figurant, de façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient (Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1967). Sans entrer dans le détail d'une interprétation psychanalytique serrée, il est tout à fait évident que le personnage de Charlotte représente un substitut de la figure maternelle. Mais au-delà, le rêve de Bagge se charge également d'une valeur symbolique, dont le sens excède celui d'une simple traduction psychologique du passé du rêveur. Il ouvre sur ce que l'écrivain appelle l' "étrange royaume de l'entre-deux", entre le réel et l'imaginaire, entre la vie et la mort. Cette dimension mythique est appelée par la recherche d'une réponse à la question du sens de la destinée de l'individu dans l'Histoire: "Peut-être que toute cette catastrophe, cette hécatombe de plus d'une centaine d'hommes ne s'est-elle produite qu'afin que quelque chose qui ne pouvait plus se réaliser dans la vie, parce qu'il était trop tard, se réalisât au-delà..." Le rêve de Bagge, comme celui de la plupart des héros holéniens, est une vision du royaume des morts. Lui-même l'interprète en ce sens, soulignant que tous ceux qu'il a rencontrés à Nagy-Mihaly, y compris Charlotte, appartenaient déjà, au moment où il les imaginait, au "royaume de l'irrévocable, dont personne ne revient". Dans cette représentation, la mort transforme rétrospectivement la vie individuelle en destinée - parenté avec L. Perutz -, cela dans la mesure où elle offre l'accomplissement d'un pré-dit, scelle un retour à l'origine. Ce qui constitue le fantastique holénien, c'est précisément que la signification fantasmatique et la signification mythique se confondent, que Charlotte puisse s'interpréter à la fois comme une figure de l'inconscient personnel de Bagge et comme une figure symbolique sortie du poème de Mallarmé explicitement cité par le texte de la nouvelle: celle dont chaque coup d'éventail, devant le miroir, fait "redescendre / Pourchassée en chaque grain / Un peu d'invisible cendre / Seule à me rendre chagrin".
Reste à éclairer la fonction que prend l'aventure onirique dans l'existence du héros. Bagge en tire une sorte de détachement souverain à l'égard de la réalité de la guerre, en particulier à l'égard des conduites fanatiques, comme celle du commandant Semmler, dont le caractère tout à fait irresponsable est à l'origine de l'hécatombe. On a beaucoup glosé sur le conservatisme de Lernet-Holenia, en oubliant parfois de relever sa condamnation sans appel du national-socialisme. En même temps, cette expérience lui prescrit une règle, peut-être insensée, de fidélité à l'égard de soi-même qui fait de lui, pour le reste de ses jours, une sorte de chevalier de l'absurde à l'image de Menis, le héros de L'Étendard, qui, dans la débâcle de la monarchie habsbourgeoise, se fait le gardien de l'enseigne sacrce de son régiment. Aventure réelle ou rêvéc, Bagge considère qu'il s'est effectivement uni à Charlotte et entend rester fidèle, indéfectiblement, à son engagement. Le fantastique, qui, chez Lernet-Holenia, naît de la coïncidence entre le fantasme et le mythe du passé, est une manière de se donner, encore, une raison de survivre.
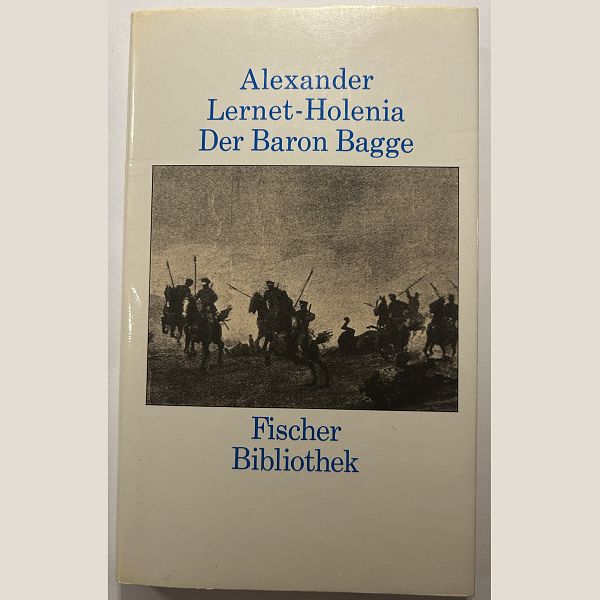
Nachwort von Hilde Spiel
In: Der Baron Bagge, S. Fischer 1978, S. 103-115.
Hätte Alexander Lernet-Holenia nur Lyrik geschrieben oder seinen eigenen höchsten Ansprüchen an die Prosa genügt, ein Platz im Pantheon der großen Geister wäre ihm sicher gewesen. Wer allzu vielseitig begabt ist, steht sich selbst im Licht. Er wird nicht immer an dem Maß seiner vollendeten Werke gemessen, sondern von der schnöden Welt nach dem beurteilt oder gar abgeurteilt, was er manchmal bedenkenlos, manchmal notgedrungen den Forderungen des Tages geopfert hat. Dieser Schriftsteller, nein, Dichter Lernet-Holenia hat sich, von der edelsten Elegik und Dithyrambik bis zu den leichtesten und seichtesten Abenteuer- und Schelmenromanen, jeder literarischen Form bedient. Anders als Rilke oder Hofmannsthal, mit denen ihn mehr verband als mit irgendeinem seiner eigenen Generationsgenossen, hat er nie, oder nur selten, mit dem Seitenblick auf den olympischen Lorbeer geschrieben oder sich etwa frivoler, bizarrer und parfümierter Einfälle begeben, weil sie das Gesamtbild seiner künstlerischen Persönlichkeit hätten beeinträchtigen können. So hat er das Monument, das seinen schönsten Hervorbringungen, den Gedichtbänden "Die goldene Horde", "Die Trophäe" und "Das Feuer", so makellosen Novellen wie dem "Baron Bagge", so wohlgebauten und profunden Romanen wie "Die Standarte", "Beide Sizilien" und "Mars im Widder" gebührt, selbst immer wieder vom Sockel gerissen.
Es verdient, neu aufgerichtet zu werden. Denn noch in den Augenblicken eines Leerlaufs seiner Inspiration, noch in seinen Irrwegen im Labyrinth des Wiener Gesellschaftsklatsches oder seinen Windmühlenkämpfen gegen den Fiskus und eine erlauchte Familie, der er selbst nicht ferngestanden haben mag, bekundet sich jene vorbildliche Sprache, die er seinen Lehrmeistern, den Romantikern, und dem großen Vorbild Kleist verdankte, schimmert immer noch ein Abglanz der erhabenen Region, in der er in Wahrheit daheim war und die er seinen Lesern immer wieder nahegebracht hat. In der Rücksichtslosigkeit, ja Unerbittlichkeit, mit der ein Dichter seine eigene, selbstgeschaffene Welt, mit all ihren schiefen und verzerrten Perspektiven, ihren Trugschlüssen und Idiosynkrasien, aber auch ihren weitläufigen Prospekten, nie zuvor gesehenen Farben, unerhörten Tönen und neuartigen Aussichtspunkten ins Jenseits, auf die greifbare und alltägliche Realität kopiert wie ein kräftiges Bild auf ein blasses, liegt die Macht seiner Genialität. In Lernet-Holenias "Auferstehung des Maltravers", einem ungleichmäßigen, aber durch erstaunliche Ausflüge ins Metaphysische geadelten Buche, steht der Satz: "Es gibt kein Kunstwerk, das nicht eine ganze Welt in sich enthielte - und wahrscheinlich eine wirklichere, als die wirkliche Welt es ist."
Freilich ist dieses Reich, wie der Traum von den Resten und Fragmenten des Wachens, nur von dem bevölkert, was vorerst der Wirklichkeit entlehnt worden ist. Doch die Imagination des Dichters setzt sich, ganz wie Traum, über alle Grenzen des Ortes und der Zeit hinweg, reicht tief in die Vergangenheit hinab, wandert auf eins, zwei in die exotischesten Länder und schlägt Brücken über den Styx, so daß die Toten mit den Lebenden zwanglos bei Tische sitzen, als gäbe es in der Tat nur ein einziges ungeteiltes Sein.
Lernet-Holenias Welt ist ohne Mühe auf seine Herkunft und Umwelt zurückzuführen. Er wurde in der österreichischen Provinz Kärnten geboren, als Sohn der zweiten Ehe der verwitweten Baronin Boyneburgk mit dem Marineoffizier Lernet, der sogleich wieder ins Dunkel verschwand, worauf sein Kind von der mütterlichen Familie adoptiert wurde und deren Nachnamen Holenia zu dem väterlichen fügte. Solch ungewöhnlicher Lebensbeginn berechtigte den Dichter mehr als manchen anderen zu jenen, der Tiefenpsychologie bekannten Phantasien über eine etwaige Verwechselung in der Wiege oder höhere Herleitung als die tatsächliche, denen Adoleszente zuweilen nachzuhängen pflegen. Seine Geburt ist in der Tat von Gerüchten umwittert, und wenn er diesen auch nicht Vorschub leistete, so hat er sie doch in seiner Lyrik, auch in diesem oder jenem Roman, nicht ganz unabsichtlich genährt.
Zur Patrizieratmosphäre Kärntens, mit dessen Adel er - wie Rilke es sich nur ersehnte - vielfach verwandt und verschwägert war, kam die sanftere und liebliche Landschaft des Salzkammerguts, in der seine Mutter bald nach seiner Geburt ein Anwesen erwarb. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, rückte Lernet-Holenia, blutjung, zu den Dragonern ein und erlebte schließlich an der russischen Front den Untergang des Habsburgerreiches, das er als eine vielfältige, prächtige und bunte, zugleich aber auch unendlich behagliche Wohnstatt geliebt hatte und dessen Zusammenbruch er überaus schmerzlich empfand. In den verzweifelten letzten Monaten der Monarchie, die Jahrhunderte gewährt hatte und jetzt vor seinen Augen versank, prägte sich dem Fähnrich nicht nur die Schönheit und Eigenart der verlorengegangenen Erblande, nicht nur die erlöschende Größe dieses gewaltigen Staatswesens ein, sondern auch die gänzliche Sinnlosigkeit und Nichtigkeit eines Strebens, dessen Tragik überflüssig und vergeblich war. Was er in dem dichtgedrängten Erlebnis des österreichisch-ungarischen Untergangs erfuhr, reichte ihm für zwei Drittel seines Werkes, reichte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem er erst der so völlig veränderten Gegenwart ins Gesicht zu blicken begann. So entstand Lernet-Holenias Welt - eine Welt der stillen großen Räume des Landadels, in denen die Sonne durch herabgelassene Jalousien auf Kirschholzmöbel scheint, vor dem Haus die bemooste Gartenmauer, der verwaschene Stein-Neptun, die silbrige Fontäne; eine Welt der grüngoldenen Salons und der blutigen Schlachtfelder, auf denen die starren, reichbestickten Embleme des Kaiserreichs blitzen; eine Welt, an der die Melancholie der ungarischen Tiefebene ebenso teilhat wie das Walddunkel der Karpaten, und der polnische Winter ebenso wie das frühlingliche Piemont, das in seinem Herzen noch zu seinem Erbe und wahren Besitz gehörte. Immer tauchen in dieser Welt dieselben Vorstellungen auf, Ängste vielleicht einer allzu behüteten und darum um so empfindsameren Kindheit - vor finsteren Gängen und leeren Vorgemächern, in denen man herumirrt und sich vor dem Entdecktwerden schützt. Und immer gerät man in ihr in den seltsamen Raum zwischen Leben und Tod, oder auf einen Waldweg, der sich in die Ewigkeit verliert. Wie manche Menschen in gewissen Abständen den gleichen Traum erfahren, im Zustand des Halbwachens den gleichen Gesichten unterworfen sind oder, sobald sie sich vom unmittelbaren Alltag lösen, den gleichen Gedanken nachhängen, ja geradezu ausgeliefert sind, so kehrt in Alexander Lernet-Holenias Werk das Motiv des allmählichen Sterbens immer wieder. Schon in seinem ersten Prosastück, der Erzählung "Nächtliche Hochzeit", ist von einer alten Dame die Rede, bei der "die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten" sich "verwischt zu haben schien" . In dem Roman "Der Graf Luna" irrt Alexander Jessiersky neun Tage in den römischen Katakomben umher und wird, sobald er meint, das Tageslicht zu erblicken, auf wunderliche Weise, und ohne daß er's wüßte, längst nach seinem Tode, in das Land seiner Kindheit, Polen, zurückversetzt. Jene neun Tage aber sind der Zeitraum, den er zum eigentlichen Sterben braucht. Am knappsten und berührendsten ist ein solcher Schwebezustand in Lernet-Holenias Gedicht "An Foscolo" geschildert, das in der Sammlung "Die Trophäe" erschienen ist:
- ob wir auf ewig fortgegangen sind.
Du selbst vielleicht, Vorausgegangener, weißt
es nicht, und bis doch längst, wohin der Staub wallt
und die er stellt, die Fragen, alle zielen
wie Pfeile, die ins Dunkel fliehen. Ja
vielleicht daß du, wenngleich dahin, nicht weißt,
daß du dahin bis, und daß auch wir selbst
vielleicht nicht wissen, daß wir schon dahin sind.
Nirgends aber, so oft er sich auch mit ihm beschäftigt hat, ist dieser Gang in "jenes unbekannte Land, aus des' Bezirk kein Wanderer wiederkehrt" , mit solcher Bildkraft, Anschaulichkeit und Traumphantasie nachgezeichnet worden wie im "Baron Bagge", der schönsten Novelle, die Alexander Lernet-Holenia geschrieben hat. Auch hier sind es neun Tage, die Bagge im Zwischenreich verbringt. Und wenn es ihm vergönnt ist, dennoch daraus wiederzukehren, so ist dies doch nicht weniger tragisch, als wäre er in der Tat gestorben, denn nicht nur seine gesamte Schwadron, auch das Mädchen, "die Geliebte, die auf mich geharrt seit je", ist ihm "ins Unzerstörbare entrückt auf immer währende Zeiten".
Das Kleistische an dieser Novelle, die knappe, dichtgewobene und doch so motorische Prosa, unaufhaltsam weiterdrängend in einem steten Fluß, ist noch erhöht und bereichert durch eine poetische Kraft, wie sie nur einem Dichter, dessen eigentliche Ausdrucksform die Lyrik ist, zu Gebote steht. Ein Nachklang jenes Rilke, der dem jungen Lernet-Holenia, als dieser zu dichten begann, unausweichlich vorgeschwebt hatte, ist in der Schilderung des geliebten Mädchens zu spüren, wenn es da heißt: "Was dort aber ein körperliches Glänzen gewesen, war hier ein Glanz von innen." Und in dem Überschwang, mit dem hier von dem "fabelhaften Azur ihrer Augen" gesprochen wird, das "Entfernungen zu spiegeln schien, in denen es Himmel und Meere gab, ungeheure Schicksale, Gold, Elfenbein und grandiose und seltene Dinge" , lebt etwas fort von der preziösen Imagerie des jungen Hofmannsthal. Am packendsten, und hier führt Alexander Lernet-Holenia weiter, was er in seinen frühen Romanen "Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen" und "Ljubas Zobel" begann, aber in der "Standarte" zur wahren Meisterschaft brachte, sind die Heraufbeschwörungen der alten Armee, ihrer Garnisonen und Kampfschauplätze an den Rändern der Habsburgermonarchie. Kein anderer - auch nicht Joseph Roth - hat mit solch sehnsüchtiger Liebe den Geist jenes so seltsam zusammengewürfelten österreichischen Militärs, seinen Zusammenhalt trotz vielfältiger Herkunft, seine Glorie und seinen schicksalhaften Zerfall darzustellen gewußt. Und keinem anderen sind Landschaftsbeschreibungen von solch zwingender Gegenwärtigkeit gelungen, Beschreibungen von Landschaften, wie sie sich einem jungen Dragonerfähnrich in den erregendsten und für immer unvergessenen Monaten und Jahren seines Kriegsdienstes in Ungarn und Ruthenien und weiß Gott wo überall noch eingeprägt hatten. Sie sind es, etwa der Rundblick von der Burg oberhalb der kleinen Stadt Nagy-Mihaly, oder der Ritt durch die Täler der Laborza und der Solinka bis ans Ufer des San, in dem das Wasser wie Glasscherben klirrt, die ihn als Erzähler höchsten Ranges ausweisen. Auf dieser Höhe, in der vorliegenden Novelle wie in seinem Gesamtwerk, sich dauernd zu halten, war ihm freilich nicht vergönnt und hat er auch nicht angestrebt. Kaum irgendwo jedoch in seinen vielen Prosahervorbringungen finden sich so viele Bilder von frappanter Unmittelbarkeit, etwa wenn "der Braune mit leichter, unendlich graziöser Bewegung des Vorderhufs im Schnee zu scharren begann", wenn im Morgentau "einige wenige Sonnenstrahlen, wie schräge Stürze funkelnden Messings", über die Ebene fallen, oder wenn aus Nagy-Mihaly, das in einen rosigen Lichternebel gehüllt ist, vom Lärm der vielen Menschen, die sich dort zusammengefunden haben, ein leises Brausen steigt. Von einzigartiger Anmut ist die Vision der Hochzeit "in dem großen, nur von einigen Kerzen erhellten Raum", darin sich, "flüsternd und von Schmuck-, Gold- und Silberstickereien funkelnd, in flüchtig übergeworfenen Pelzen die Masken" drängten, "während der Geistliche die Traurede hielt". Und nicht von ungefähr läßt sich dieser ganze seltsame Kostümball, der in der Trauung endet, dem Maskenfest in Alain-Fourniers "Le Grand Meaulnes" vergleichen. Denn hier wie dort geht es um einen Traum, der die Wirklichkeit an Schärfe und Eindruckskraft bei weitem übertrifft.
Mit zartester Hand sind jene Hinweise verstreut, daß es sich bei dem neuntägigen Ritt etwa nicht um einen realen Vorgang handeln könne, sondern um die Einbildung eines Sterbenden, der sich freilich noch einmal ins Leben zurückretten kann. Gewiß, gleich zu Beginn wird von dem Herrn von Semler zu Wasserneuburg gesagt, es sei die Katastrophe, in die er seine Schwadron geführt habe, die Opferung dieser ganzen Hekatombe von Menschen und Rossen, nur dazu dagewesen, "damit etwas, das im Bereiche des Lebens, weil es dazu zu spät war, nicht mehr geschehen konnte, nach dem Leben geschehe" . Hier ist auch ausdrücklich die Rede von "jener Zeit und jenem Raum, die zwischen dem Sterben und dem wirklichen Totsein liegen. Denn daß es da ein Intervall gebe, halten viele für sicher. Nach einigen währt er nur Augenblicke, nach anderen Tagen, äußerstenfalls, sagt man, neun. Sonst hätte man doch auch, zumindest früher, die Toten schneller begraben." Aber es wird nirgends vorhergesagt, daß der Baron Bagge, was er nun erleben soll, selbst in einem solchen Intervall erleben würde. Nur aus geringfügigen Verschiebungen, Abweichungen, Unwahrscheinlichkeiten, die jedoch nie zu Unmöglichkeiten werden, mag man in steigendem Maße entnehmen, daß es hier mit rechten Dingen nicht zugehen kann.
Der Baron berichtet selbst, daß ihn zuweilen "das beunruhigende Gefühl von einer Traumhaftigkeit meines ganzen Zustandes" befällt und er einen Augenblick zweifelt, "ob wirklich ich es sei, der hier war, etwa wie wenn einen manches Mal beim Gehen, Fahren oder Reiten ein schwindelnder Zweifel befällt, ob man selber es sei, der da geht, fährt oder reitet". Aber gerade, daß dieses Gefühl - auch schon von Hofmannsthal beschrieben - jedem Leser geläufig ist, drängt den Gedanken, Bagge könnte in der Tat nur träumen, in den Hintergrund. Vielmehr ist es die merkwürdige Anhäufung und übermäßige Lebenslust der Menschen in der kleinen Stadt, sind es die unwahrscheinliche Vertrautheit, mit der Charlotte dem Baron zum ersten Mal entgegentritt, die unerklärliche Abwesenheit des Feindes in einem Gebiet, in das die Russen eigentlich längst eingerückt sein müssen, und schließlich die seltsame Jagd auf Truthähne, die in Bäumen sitzen, mit einer Kentucky-Rifle des Leutnants Hamilton, welche dieser bisher nicht bei sich gehabt hat, woraus man schließen mag, all dies habe sich nur in der Vorstellung des Erzählers, nicht aber in Wahrheit abgespielt.
So allmählich und stufenweise verstärkt sich dieser Eindruck, daß man, fast ohne es zu merken, in die letzte Phase der Wanderung, und damit in die weiteste Entfernung von der Realität eintritt. Erst wenn alles zu glimmen und schimmern und leuchten beginnt, wenn ein unnatürliches Licht von den Reitern und Pferden ausgeht, wenn endlich die Brücke, eine neue und doch die alte, die zu Anfang mit dem gesamten Troß überquerte und von den Russen verteidigte Brücke von Hor, auf der Bagge die beiden - nahezu tödlichen - Geschosse getroffen hatten, ihm als mit Gold beschlagen erscheint, wird das Geheimnis offenbar, erkennt der Leser im selben Augenblick wie der Erzähler mit absoluter Sicherheit, daß hier ein Traum ausgeträumt ist, daß volle acht Tage in wenigen Sekunden verstrichen sind und am neunten an den ersten wieder angeknüpft wird.
Diesen neuntägigen Weg des Todes, "wie er vorgezeichnet ist in den Mythen", ist Alexander Lernet-Holenia selbst gegangen, als er in seinem neunundsiebzigsten Jahre starb. Am dritten Juli 1976 hatte ihn der Tod ereilt. Am zwölften wurde er begraben. Es war nicht, als hätten die Hinterbliebenen dafür gesorgt, daß diese Spanne verstrich, bevor man ihn der Erde übergab. Ganz unvermeidlich hatte es sich so gefügt. Aber wie er selbst über Hofmannsthal sagte, daß dieser in seiner Jugend und wiederum in reifen Tagen mit ungewöhnlichen Kräften, mit einer prophetischen Magie begabt gewesen sei, so war Alexander Lernet-Holenia selbst auf eigentümliche Weise "erleuchtet" sein ganzes Leben. Daß er sich trotzdem den trivialsten Beschäftigungen und Schreibarten hingab, steht dazu nicht im Widerspruch. Wer ihn kannte, weiß um die Distanz, die er bei aller Liebenswürdigkeit zu seiner Umwelt hielt, weiß auch, daß sein Talent, oder wenn man will, sein Genie, nicht der Ratio entsprungen sein konnte. Er schrieb zumeist flink, leicht und wie unter einem Diktat, als hätte der Mensch, der da am Schreibtisch saß, mit ihm und seiner gesellschaftlichen Erscheinungsform nichts zu schaffen. Der unerklärte Begriff der Inspiration, hier war er am Platz. Sobald seine Inspiration ihn im Stich ließ, war er zum Absinken verurteilt. Aber sie kehrte zu ihm zurück, wenn er ihrer wahrhaft bedurfte, sie enthüllte ihm das Zeichen, unter dem sein Dasein stand, und hatte ihn, wann immer er hellhörig für ihre Botschaften war, auch sein eigenes Ende ahnen lassen.