Hans Sarkowicz und Alf Mentzer zu Lernet-Holenia (2011)
Schriftsteller im Nationalsozialismus - Ein Lexikon
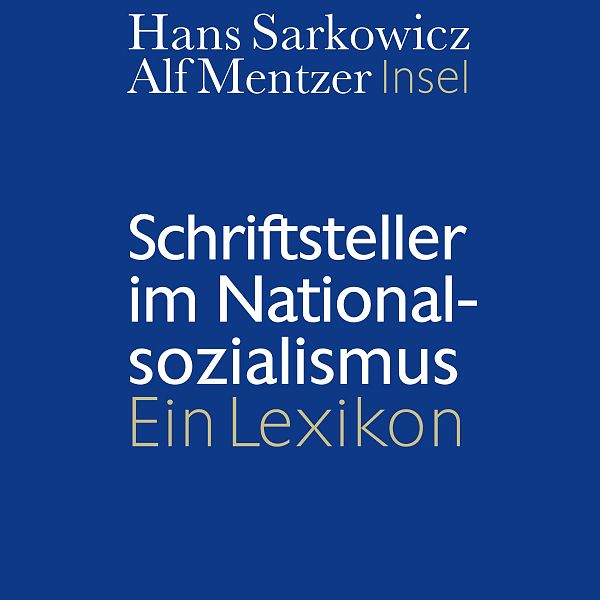
In: Schriftsteller im Nationalsozialismus - ein Lexikon, Insel Verlag, 2011
Lernet-Holenia, Alexander
(auch: Clemens Neydisser, G. T. Dampierre)
*21.10.1897 Wien † 3.7.1976 ebd.
Der Sohn des Linienschiffsoffiziers Alexander Lernet (oder möglicherweise des Erzherzogs Karl Stephan) und der verwitweten Baronin Sidonie von Boyneburgk-Stettfeld, geborene Holenia, meldete sich nach dem Abitur 1915 freiwillig zum Militär. Nach Kriegsende kämpfte er für kurze Zeit in der Kärntner Heimwehr: Seine persönlichen Erfahrungen als Rittmeister der k.u.k. Armee und der Untergang des Habsburgerreichs prägten Lernet-Holenias frühe Prosaarbeiten. Nach stark an Rilke angelehnten Gedichten, spätexpressionistischen Dramen und Komödien hatte er 1931 seinen ersten großen Erfolg mit dem Roman Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen (Berlin). Die im Ersten Weltkrieg in Russisch-Polen spielende Verwechslungs- und Verratsgeschichte wurde 1934 in Deutschland unter der Regie von Gustav Fröhlich verfilmt. Im selben Jahr erschien Lernet-Holenias berühmtester Roman Die Standarte (Berlin), der zuvor in der Berliner Illustrirten Zeitung unter dem Titel Mein Leben für Maria Isabella (so auch der Titel der Verfilmung aus dem Jahr 1934) vorabgedruckt worden war. Die Liebesgeschichte zwischen einer Serbin und einem österreichischen Fähnrich, dessen Traum, einmal die Standarte seinem Regiment ›Maria Isabellas vorantragen zu dürfen, sich erst am Ende des Kriegs bittererfüllt, stieß, wie die meisten Romane Lernet-Holenias, bei der NS-Kulturbürokratie auf Skepsis und Ablehnung. Die Darstellung des Kriegs als großes Sittengemälde ohne Sieger und Besiegte, als breit angelegtes Panorama des Untergangs entsprach nicht den gängigen Erwartungen von nationaler Erweckung im Schützengraben und von Frontkämpfern, die schon ein neues, starkes Reich beschworen und bloß noch auf ihren Führer warteten. Obwohl die leicht erzählten und oft mit phantastischen Elementen durchsetzten Romane populäre Filmstoffe hergaben, untersagte Hans Hinkel als Geschäftsführer der Reichskulturkammer die weitere Umsetzung. Bei dem Autor handele es sich, so Hinkel am 3. Juni 1936, »um eine zwar geschickte aber auch ebenso unzuverlässige Systemgröße, deren Produkte durch die ehemals uns feindliche Presse hoch gelobt und besonders herausgestellt wurden. Die Filmproduktionsgesellschaften sollten sich einmal mit Hanns Johst und seinen Mitarbeitern ins Benehmen setzen; sie werden dann unter hunderten von Büchern anständiger Autoren auch das eine oder das andere finden, das sich zur filmischen Gestaltung eignet und bei einer Verfilmung die Aussicht auf ›Rentabilität‹ mitbringt« (Bundesarchiv Berlin RKK 2100-023705). Lernet-Holenias Roman Jo und der Herr zu Pferde (Berlin 1933) wurde sogar offiziell verboten.
Trotzdem konnten die neuen Manuskripte von Lernet-Holenia zunächst ungehindert gedruckt bzw. verkauft werden: u.a. Die Auferstehung des Maltravers (Wien 1936), Der Baron Bagge (Berlin 1936), Der Mann im Hut (Berlin 1937) und Ein Traum in Rot (Berlin 1939). Roman Rocek wies in seiner Lernet-Holenia-Biographie nach, daß es in diesen Büchern zahlreiche politische Anspielungen gibt - die sich allerdings nur einem sehr aufmerksamen Leser erschließen und deshalb wohl auch von der Zensur übersehen wurden.
Sehr viel deutlicher sind die aktuellen Bezüge und Ressentiments in dem Roman Mars im Widder, der unter dem Titel Die blaue Stunde und um wesentliche Passagen gekürzt 1940/41 von der Zeitschrift Die Dame vorabgedruckt wurde. Lernet-Holenia, der im August 1939 zum Militär einberufen worden war, schildert darin - kaum verschlüsselt - den deutschen Überfall auf Polen. Die Buchfassung war vom Oberkommando der Wehrmacht bereits freigegeben und vom S. Fischer Verlag in 15 000 Exemplaren gedruckt worden, als das Propagandaministerium Mitte 1941 die Auslieferung verbot. Der Roman konnte erst 1947 bei Bermann-Fischer in Stockholm erscheinen.
Im Sommer 1941 wurde Lernet-Holenia als Leiter des Entwicklungsstabs in die Heeresfilmstelle berufen mit der vorrangigen Aufgabe, Drehbücher zu schreiben. Offensichtlich war der Mangel an guten Drehbuchautoren so groß, daß auch ein als politisch unzuverlässig geltender Schriftsteller im Offiziersrang in die NS-Unterhaltungsindustrie eingegliedert wurde. Von ihm stammte die Idee für die kommerziell erfolgreichste Produktion der NS-Zeit: Die große Liebe mit Zarah Leander (UA 12.6. 1942). Der Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, handelt von der Affäre eines Fliegerleutnants mit einer berühmten Sängerin. Proteste des Oberkommandos der Wehrmacht, das um das Ansehen seiner Offiziere fürchtete, wurden von Göring und Goebbels ignoriert.
Wie die Personalunterlagen aus dem Bundesarchiv zeigen, gehörte Lernet-Holenia zumindest in den Jahren 1940 bis 1942 durch seine Buchveröffentlichungen, Zeitungsartikel, Zeitschriftenbeiträge und vor allem seine Filmarbeit zu den literarischen Spitzenverdienern in Deutschland. Und doch blieb er als aristokratisch geprägter Konservativer auf Distanz zum NS-Regime.
Nach Kriegsende konnte er mit Neuauflagen seiner alten Bücher und mit neuen Romanen an seine früheren Erfolge anknüpfen. 1972 trat er aus Protest gegen die Verleihung des Literaturnobelpreises an Heinrich Böll von seinem Amt als Präsident des österreichischen PEN-Clubs zurück. Um sein Nachleben kümmern sich die Internationale Alexander-Lernet-Holenia-Gesellschaft und eine nach ihm benannte Forschungsstelle in der Wetzlarer Phantastischen Bibliothek. Mit dem Werk von Lernet-Holonia gibt es eine anhaltende und intensive literaturwissenschaftliche Beschäftigung.
Weitere Bücher:
Ich war Jack Mortimer. Berlin 1933. - Die neue Atlantis. Berlin 1935. - Die goldene Horde. Wien 1935. - Der Herr von Paris. Wien 1936. - Mona Lisa. Wien 1937. - Riviera. Berlin 1937. - Strahlenheim. Berlin 1938. - Beide Sizilien. Berlin 1942. - Das lyrische Gesamtwerk (hrsg. von Roman Rock). Wien/Darmstadt 1989. - Carl Zuckmayer/Alexander Lernet-Holenia: Briefwechsel. Hrsg. von Gunther Nickel. In:
Zuckmayer-Jahrbuch 8 (2006), S. 9-185.
Literatur
Ingeborg Brunkhorst: Studien zu Alexander Lernet-Holenias Roman ›Die Standarte‹. Stockholm (Diss.) 1963. - Franziska Müller-Widmer: Alexander Lernet-Holenia. Grundzüge seines Prosawerks dargestellt am Roman ›Mars im Widder‹. Bonn 1980. - Yeong-Suk Han: Alexander Lernet-Holenia. Studien zu einer Monographie. Wien (Diss.) 1985. - Reinhard Lüth: Drommetenrot und Azurblau. Studien zur Affinität von Erzähltechnik und Phantastik in Romanen von Leo Perutz und Alexander Lernet-Holenia. Meitingen 1988. - Robert von Dassanowsky: Between Empire and Province, or The Sleepwalkers: An Allegory of Austrofascism in Alexander Lernet-Holenia's Die Auferstehung des Maltravers. In: Donald G. Daviau (Hrsg.): Jura Soyfer and His Time. Riverside 1995, S. 287-320. - Robert Dassanowsky: Phantom empires. The Novels of Alexander Lernet-Holenia and the Question of Postimperial Austrian Identity. Riverside 1996. - Roman Roek: Die neun Leben des Alexander Lernet-Holenia. Eine Biographie. Wien/Köln/Weimar 1997. - Robert von Dassanowsky: Österreich contra Ostmark: Alexander Lernet-Holenias ›Mars im Widder‹ as Resistance Novel. In: Johann Holzner / Karl Müller (Hrsg.): Literatur der ›Inneren Emigration‹ aus Osterreich. Wien 1998, S. 157-179. - Thomas Eicher/Bettina Gruber (Hrsg.): Alexander Lernet-Holenia. Poesie auf dem Boulevard. Köln / Weimar / Wien 1999. - Thomas Eicher (Hrsg.): Im Zwischenreich des Alexander Lernet-Holenia. Lesebuch und »Nachgeholte Kritik«. Oberhausen 2000. - Hélène Barrière / Thomas Eicher / Manfred Müller (Hrsg.): Personalbibliographie Alexander Lernet-Holenia. Oberhausen 2001. - Gerald Funk: Alexander Lernet-Holenias Prosawerk im Dritten Reich. Wetzlar 2002. - Hélène Barrière / Thomas Eicher / Manfred Müller (Hrsg.): Schuld-Komplex. Das Werk Alexander Lernet-Holenias im Nachkriegskontext. Oberhausen 2004. - Thomas Hübel / Mantred Müller / Gerald Sommer (Hrsg.): Alexander Lernet-Holenia. Resignation und Rebellion. Riverside 2005. - Wynfried Kriegleder: Der Irre und die sieben Soldaten. Alexander Lernet-Holenias ›Beide Sizilien‹ als politischer Roman. In: Modern Austrian Literature 40 (2007), S. 59-79.