Roman Roček zu Lernet-Holenia (1998)
Zwischen Subversion und Innerer Emigration
Alexander Lernet-Holenia und der Nationalsozialismus
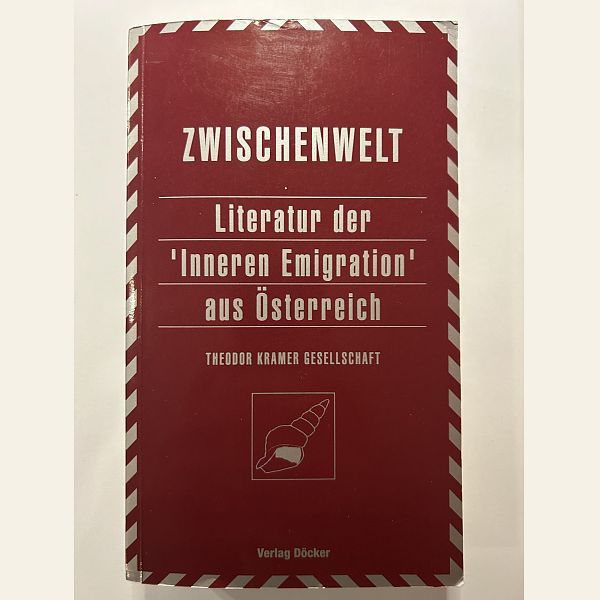
In: Zwischenwelt - Literatur der „Inneren Emigration“ aus Österreich.
Band 4, Döcker Verlag, Wien 1998, S. 181-211.
Es gibt eine Anekdote, die wie wenige sonst den ambivalenten Charakter Alexander Lernet-Holenias erkennen läßt. Kurz nach dem Erscheinen seiner Meisternovelle „Der Baron Bagge" soll eine junge Frau ihn zu den Motiven und Hintergründen der Entstehung dieses Buches befragt haben. Von den meisten Kritikern als ein Gipfel der Erzählkunst der Jahre zwischen den beiden Weltkriegen gepriesen, ist im „Baron Bagge" unverkennbar die nüchterne Erzählhaltung Kleists mit einem emotionell stark aufgeladenen Traumgeschehen zu übersinnlicher Realität verschmolzen. „Ich kann dazu nur so viel sagen", soll Lernet der Fragerin erwidert haben, „daß meine Mutter, deren Familie eine unverhältnismäßig hohe Kriegsanleihe gezeichnet hatte, 1918 fast völlig verarmt war; daß ich selbst schließlich nichts anderes gelernt habe, als einigermaßen passabel zu schreiben; daß ich aber aus - wenn Sie so wollen - Gewohnheit das Geld auch weiterhin mit vollen Händen ausgab und deshalb gezwungen war, Romane und Geschichten zu schreiben.“(1)
Abgesehen von seiner sprichwörtlichen Kaltschnäuzigkeit, kann man aus dieser Anekdote Eigenschaften herausschälen, die für den privaten wie für den Lernet der Öffentlichkeit in hohem Maße charakteristisch sind. Da ist einmal die beinahe brutal zu nennende Aufrichtigkeit, mit der dieser Autor nicht nur seine Verehrer, sondern gleichermaßen Journalisten, vor allem aber die zu schockieren oder zu täuschen pflegt, die den Kulturbetrieb in Gang halten. Er ist ein Meister der kalkulierten Provokation, versteht es daher virtuos, sie zu einer literarischen Qualität emporzustilisieren. Man ist mithin nur dann imstande, sein Werk richtig zu lesen, wenn man die Dandyhaftigkeit seines Wesens zu allem hinzudenkt, was er geschrieben hat. Dazu aber gehören -
seinen ersten Führerschein erwarb er übrigens bereits 1922 - von Anfang an Autos ebenso wie der Flor rasch wechselnder Freundinnen, die seine lang ausgedehnten Parties in dem Landhaus in St. Wolfgang lärmend durchtoben.(2)
Er ist ein ausdauernder, überaus gewandter Schwimmer, der den Wolfgangsee wiederholt in allen Richtungen durchquert hat. Nach eigenen Plänen läßt er sich besonders leichte Ruderboote anfertigen, nur um eine noch größere Beweglichkeit und Wendigkeit zu erzielen. Mit dem auf der Halbinsel unmittelbar ihm gegenüber wohnenden Schauspieler Emil Jannings veranstaltet er so manches Wettrudern. Auch nimmt er regelmäßig an den offiziellen Regatten teil, und nur selten, ohne einen Preis nach Haus zu tragen. Freunde berichten, daß es oft den Anschein hatte, als betreibe er das Schreiben nur nebenher. Die Arbeit geht ihm zwar nicht leicht von der Hand, denn
er ist ein fast manischer Korrigierer mit immensem Papierverbrauch. (3) In der Phase des Konzipierens wirft er aber seine Gedanken und Visionen wie unter einem unhörbaren Diktat aufs Papier. Oft diktiert er einer Freundin, gelegentlich auch einem Freund, den einen oder anderen Akt eines Theaterstücks oder, was nicht derart nahe liegt, ganze Kapitel eines Romans. (4)
Mit der Intuition hat er keine Schwierigkeiten, wohl aber fehlt es ihm nicht selten an Zeit, das Geschriebene wieder und immer wieder abzuschreiben. Deshalb klebt und klittert er die Seiten, bis sie aussehen wie ein kompliziertes Puzzle oder eine jener Collagen, über die er sich so oft lustig macht. Die Entzifferung überläßt er dann der Abschreiberin. Das erklärt die ungleiche Qualität seiner Bücher. Andererseits ist der Sport, den er betreibt, nicht bloß Attitüde. So sind, wie Lernet-Holenia mir in einem unserer zahlreichen Gespräche mitgeteilt hat, die Konzepte und Aufrisse seiner Arbeiten zumeist beim Schwimmen, auf der Ruderbank, aber auch während Straßenbahn- oder Eisenbahnfahrten entstanden. Den Entwurf zum relativ komplizierten Handlungsschema der „Österreichischen Komödie" etwa hat er auf einem Fahrschein der Wiener Straßenbahnen zwischen Mariahilf und Südbahnhof notiert.(5)
Solch scheinbarer Müßiggang entspringt bei ihm aber nur in Randbereichen aristokratischen Allüren; er wurzelt vielmehr in der tiefsitzenden Abneigung gegen den Beruf als Schriftsteller, den auszuüben Lernet, mangels anderer Alternativen, gleichwohl gezwungen ist. Seinem Selbstverständnis nach ist Lernet-Holenia Dichter mit dem für das Griechentum durchaus legitimen Anspruch, als ein vom Daimonion Ergriffener hinter die Natur, die Beschaffenheit menschlicher Bestimmungen und
Geschicke zu sehen, einem Anspruch, den unser Zeitalter allerdings abgetan, verworfen und gegen mannigfache Strategien des Ausdrucks und der Marktgängigkeit eingetauscht hat. Um sich also nicht selbst zum Narren machen zu lassen, muß der Dichter versuchen, die andern zum Narren zu halten, an der Nase herumzuführen. Das ist ihm bis zu einem gewissen Grad auch gelungen. Eine Anzahl von Romanen und - bis auf wenige -nahezu alle seiner Theaterstücke tragen Stigmen solcher Marktgängigkeit, des Haschens nach Effekt, des Boulevards.
Doch steckt noch hinter dieser dandyhaften Existenz die unverkennbare Absicht, die Gesellschaft zu verändern, sie zu erneuern. Daß dies in einer Welt, die vom Marktgeschrei konkurrierender Medienreiche zerrissen ist, allein durch gezielte Provokationen erreicht werden kann, hat Lernet schon in frühen Jahren an sich erfahren und praktiziert. Sein Zynismus wurzelt indes keineswegs in der Auflehnung um ihrer selbst willen, er wurzelt vielmehr in der Erkenntnis, in der bestürzenden Erkenntnis, eben jene Gesellschaft, die es abzulehnen, ja, mitunter sogar zu bekämpfen gilt, mit
Ideen und Büchern beliefern zu müssen, um überhaupt leben zu können. Daß solche Kämpfe zudem - und das ist das für seine Haltung entscheidende Paradoxon - ausgerechnet im Medium des Buches ausgetragen werden, zeichnet ihn mit den „dämonischen Spuren von Zweideutigkeit, wie sie allen Dichtern anhaften, die durch diese Hölle zu wandeln haben."(6) Darum wird, was er darüber hinaus sonst noch schreibt, etwa Gedichte, Balladen oder schwerblütige Oden, zu der für ihn charakteristischen Art von Verweigerung: scheu verbirgt er sie vor dem breiten Publikum, indem er sie nur in kleinen Auflagen und noch dazu meist in versteckten Verlagen erscheinen läßt.(7)
Dennoch darf man nicht übersehen, daß Lernet-Holenia vom Gedicht her in die Literatur eingetreten ist, vom hoch stilisierten Gedicht, wie man unbedingt hinzufügen muß. Er veröffentlicht drei Gedichtbände, bevor sein erstes Theaterstück aufgeführt wird. Nicht ohne Erfolg versteht er es, sich verschämt hinter der Maske des jovialen Landedelmanns zu verbergen, der sich scheinbar dem Müßiggang verschrieben hat und mit der Linken erledigt, was er gerade zum Leben braucht. Als Peter Suhrkamp, der kommissarische Leiter von Lernets Stammverlag S. Fischer, ihm 1943 vorschlägt, seine bisherigen Gedichte zu sammeln und um einen Band neuentstandener anzureichern, da winkt er ab: Es sei hierzu jetzt nicht die Zeit, nach dem Krieg vielleicht. Lernets Ablenkungsmanöver von allem, was dazu beitragen könnte, ihn als Dichter zu demaskieren, erinnern ein wenig an die Scheu des alternden Verdi, die späten Opern, diese Spiele eines Einsamen, doch noch dem Publikum preiszugeben.
Lernet-Holenias gesellschaftliche Spaltung, seine Dichotomie in einen Mann der Feder, der sich Öffentlichkeit unter allen Umständen erzwingt, und in einen, der sich ihr widersetzt, bringt ihn zeit seines Lebens immer ein wenig in Gefahr, „über den Anforderungen, welche die Lebensführung eines Kavaliers und Gentlemans an ihn stellte, seine Berufung zu vergessen."(8) Doch bleibt er sich stets der Tatsache bewußt, daß die Zeit der großen Stilisten ein für allemal vorbei ist, ebenso vergangen wie die Zeit des sittlich hochstehenden Adels, von dem Marie von Ebner-Eschenbach fordert, er habe die Pflicht, auf das Wohlergehen seiner Untertanen, nicht aber darauf zu achten, ob seine Privatkassen gefüllt sind.(9)
Denn ebenso wie für die Ebner soll der Adel auch für Lernet-Holenia eine ethisch-moralische Vorbildfunktion erfüllen. Daß er sie nicht erfüllt oder nur noch in Ausnahmefällen erfüllen kann, dieses Wissen ist zur Keimzelle jenes kaustischen Humors geworden, der die eigentliche Stilcharakteristik Lernetschen Dichtens ausmacht. Deshalb ist es falsch, das Komödiantische in seinen Werken, dieses über weite Strecken ausufernde, scheinbar belanglose Parlando - wie das immer wieder geschehen ist - als den Versuch anzusehen, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Es
ist vielmehr das mit sprach-immanenten Mitteln unternommene Beginnen, „Die Welt von Gestern" zwischen den Buchdeckeln aufzuheben und sie damit gleichermaßen zu bewahren wie der Lächerlichkeit preiszugeben. Das gilt durchaus noch für die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen. Denn ähnlich wie für Thomas Mann, für den das 19. Jahrhundert erst im Jahre 1918 endet, verfällt für Lernet-Holenia Altösterreich erst mit dem Einmarsch der Truppen Hitlers. (10) Er hat sich darüber unmißverständlich geäußert:
"Mit Hitler sei keineswegs das Proletariat zur Herrschaft gekommen, sondern der Pöbel
an die Macht gelangt." (11)
1. Der Mann im Hut
Wenn also ein junger Mann von Alexander Lernet-Holenia 1937 auf die Reise geschickt wird, um den Schatz Attila-Etzels zu finden, dann braucht man gar nicht erst eine Identifikation mit dem germanischen Mythos zu erwarten oder zu befürchten. (12) Der junge Mann hat im Spiel verloren und zahlt, da er kein Geld, wohl aber einen schnellen Wagen hat, seine Schulden damit ab, den Gewinner rund um Tokaj zu kutschieren. Dabei verlieren sich die beiden nicht nur in recht sonderbare Gegenden, sondern auch in das Gestrüpp der bezüglichen Heldenmythen. Daß es dabei nicht um orthodoxe Auslegungen der Nibelungensage geht, sondern um überaus komische Pastiches der NS-Germanistik, sorgt ebenso für wohldosierten Humor wie für die schlagartig einsetzende Erkenntnis, der junge Mann stehe stellvertretend für Deutschland, das nach dem verlorenen Krieg in der Vergangenheit nach verborgenen oder besser: nach verlorenen Schätzen gräbt.
Aber es ist nicht der Nibelungenhort, worum es dem unheimlichen Beifahrer des jungen Mannes geht, es ist vielmehr der Schatz Attila-Etzels, den die vom Westen in den Osten Reisenden heben und an sich bringen möchten. Sie bilden dabei gewissermaßen die private und zweifellos harmlos-groteske Vorhut von Hitlers Heerscharen, die bloß zwei Jahre nach dem Romangeschehen aufbrechen werden, den Osten zu erobern. So kühn es vielleicht auch anmuten mag, daß ein bei S.Fischer bereits zur Zeit Hitler-Deutschlands erschienener Roman derlei Symbolik ungestraft transportiert, so wäre es hingegen falsch, die hier anklingenden, im Roman variiert immer wiederkehrenden Themen als Überinterpretationen abzutun, die in den Text etwas hineingeheimnissen, was der Autor gar nicht hat hineinsehen wollen.
Man darf aber vor allem nicht vergessen, daß Lernet-Holenia in seinen Bühnenstücken und Romanen Situationen von hintergründiger Komik erfindet, die ihre irritierende Wirkung aus dem Überlappen von Vordergrundrealität und einem verborgenen Bedeutungszusammenhang beziehen. Oberflächlich besehen, ist Lernet ein Autor, der an die Tradition der Abenteuerromane anknüpft und, darin Fielding, Sterne und Gogol verwandt, seine weitgehend pessimistische Einstellung zur ironischen Weltsicht, zur Darstellung der Gebrochenheit des Daseins erweitert. Er bedient sich dabei keineswegs des kontinuierlichen Erzählens, sondern der Melange mannigfaltiger Stilmittel, durch die kolportierte Realitäten zu oszillieren, zu schillern beginnen. Zielrichtung seines Spottes sind die Schwächen der Systeme und die Charakterdefekte der Mitmenschen, die er mit feiner Feder karikiert und persifliert. Difficile est, satiram non scribere!
Aber er weiß auch, was Karl Kraus der Generation um den Ersten Weltkrieg in die Ohren gehämmert hat: „Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten."(13) Deshalb verwendet Lernet in den Romanen, die er während der NS-Zeit schreibt, ein Verfahren der absichtlich korrumpierten Kontinuität und deponiert seine Botschaft an möglichst weit auseinanderliegenden Stellen des Erzählkontinuums. So entstehen Bedeutungsnester, die erst zusammengesucht, zusammengesehen werden müssen, will man erkennen, welche Inhalte seine Romane tatsächlich transportieren.
In einem dieser Bedeutungsnester etwa ist die Verkündigung des großen Unwetters versteckt, das über das Land hereinbrechen wird. Lernet tarnt die politische Vorhersage – und das ist zu dieser Zeit schon gewagt - in dem pittoresken Zug von Zigeunern, deren Frauen singend übers Land gehen und sich dabei in hieratischem Tanz drehen. Wahrsager, Gesundbeter, Frauen, die aus der Hand lesen, begleiten den Zug. Es ist ein Regentanz, doch die, die den Regen hinter sich herzuziehen suchen, haben die Richtung verloren. Sie vermeinen das Unwetter aus dem Osten herbeizuzaubern, während es tatsächlich aus dem Westen kommt. „Das Wetter wird nicht aus dem Osten kommen, sondern aus dem Westen“(14), läßt Lernet den „Mann im Hut" drei, vier Mal auf knapp zwei Seiten sagen. Auf einen lauten Peitschenknall, den er in die Luft führt, prasselt schließlich vom Westen her ein schweres Unwetter auf die Gruppe nieder und beendet mit seinem Furioso diese scheinbar bloß folkloristische Episode, voll von malerischen Details. (15) Wie wichtig sie dem Autor freilich ist, um die darin versteckte Botschaft angemessen zu verpacken, geht aus ihrem Gesamtumfang hervor: Es sind nicht weniger als 15 Seiten vom Eintreffen des Zigeunerzuges bis hin zum abschließenden Ostinato:„Ich sah doch gleich, daß das Wetter [...]."(16)
Näher an den versteckten Bedeutungskern heran führt - rund 170 Seiten später - die Episode, in der „Der Mann im Hut", ohne freilich sein eigenes Geheimnis zu lüften, auf eine Tokajer Ortssage eingeht. Von einem Hünengrab aus spukt dort ein Mann mit sonderbar geformtem, hochstumpigem und breitkrempigem Hut, der in der Dämmerung aussieht wie ein germanischer Helm. Es gibt, so führt der Mann im Hut weiter aus, nur drei Männer in der deutschen Geschichte, die das Volk sich in
altertümlichen Hüten vorstellt: Es sind das Odhin, Hagen, Bismarck - und Hitler, ist man versucht hinzuzufügen. Denn auch Hitler trägt, bevor er an die Macht kommt, Hüte mit breiten Krempen und hohen Stumpen. Geflissentlich hat der Autor aber Hitlers Namen ausgespart. Denn was jetzt kommt, hätte ihn leicht verraten können: Alle drei haben versucht, die Geltung Deutschlands zu festigen, ihnen sei aber ein Untergang größten Ausmaßes gefolgt. Von Hagen weiß „Der Mann im Hut' sogar, daß er bewußt auf das Ende hingearbeitet hat. (17)
Das läßt sich ohne weiteres auch von der Titelfigur dieses Romans sagen. Er wird von Dieben, die in der Umgebung von Tokaj ihr Unwesen treiben, erschossen. Als man in ihren Unterschlupf, in die Grabkammer der Kapelle eindringt, die sich auf der Spitze eines kegelförmigen, gar nicht so recht in die Gegend passenden Hügels erhebt, löst sich ein Schlußstein und gibt den Blick in eine weitere Grabkammer frei. Im Schein der Lampen sieht man drei prunkvoll gekleidete Gestalten. „Dies mußten, dies konnten, obenauf im Hügel aus Toten liegend, nur die drei Könige von Burgund sein, über ihren erschlagenen Marschällen, Truchsessen und Schenken, über ihren tausend und sechzig Edelleuten und neuntausend Knechten, über gefallenen Hunnen, Thuringiern, Goten und Dänen, über den Erschlagenen ihrer Erschlagenen, über diesen Türmen aus Tausenden und Tausenden von Toten und Toten bestattet."(18)
Eine grausige Vorstellung, dieser Todesturm, in dem die Herrscher buchstäblich auf den Gebeinen ihrer Gefolgsleute ruhn! Und zugleich eine eindringliche Warnung vor jeder weiteren Ostlandfahrt, wie sie deutsche Stämme als Gegenvölkerwanderungen immer wieder konzipieren und unternehmen, am radikalsten freilich Hitlers Divisionen, denen die methodische Germanisierung der Ostgebiete anbefohlen ist. Die magische Anziehungskraft, wie der Osten sie ausübt, weckt Aggressionen und nährt den Nationalismus nicht weniger Deutscher, die von dort die eigentliche Bedrohung ihres Volkstums auf sich zukommen sehen. Wovor also Lernet nicht nur in diesem Buch, sondern auch in den beiden darauf folgenden, direkt auf die Nationalsozialisten Bezug nehmenden Romanen immer wieder warnt, das ist die mehr oder minder offen deklarierte Absicht des „Dritten Reichs", sich mit den Völkem des Ostens militärisch auseinanderzusetzen, sie also zu versklaven.
2. Ein Traum in Rot
Alexander Lernet-Holenia, der in seinen gelungensten Romanen etwas von der visionären Kraft echter poetischer Antizipation erkennen läßt, schreibt in den Jahren rund um die Besetzung seiner Heimat Österreich eine Art von subversiver Romantrilogie, in die er seine Ahnungen um die Zukunft NS-Deutschlands verpackt. Es ist dies freilich eine Trilogie, die weder der Fabel noch den darin vorkommenden Figuren nach zusammenhängt. Was sie vielmehr zusammenhält, das ist die durchgängig spürbar werdende Lust, sich an den Hypertrophien des Ungeistes der Zeit zu reiben, sie
zu ironisieren. Den ersten Band dieser kryptischen Trilogie bildet der bereits skizzierte Roman „Der Mann im Hut", der zweite trägt den Titel „Ein Traum in Rot" und ist ebenfalls bei S.Fischer erschienen. 19 Allerdings nimmt er in keinem seiner Bücher das Ende des Dritten Reiches in derart anschaulicher poetischer Vision vorweg, wie er es im Roman „„Der Mann im Hut" getan hat: das Volk, ein Leichenberg, der zum imposanten Fundament für die Katafalke seiner Herrscher geworden ist. Anders in „Ein Traum in Rot": Obwohl an seinem Ende immerhin ein Zusammenbruch in der Größenordnung und im Stil der „Götterdämmerung" steht, warnt dieser Roman alles in allem subtiler.
Es ist ein Buch nicht endenwollender Palaver, eines, dessen Architektonik, dessen poetische Struktur aus Dialogen aufgebaut ist, die scheinbar in sich selbst rotieren, an entscheidenden Stellen aber in manische Monologe explodieren. In diesem Roman ist eine ähnliche Verselbständigung von Sprache wiedererreicht wie schon früher in der „Österreichischen Komödie“ (20) oder in deren Vorbild, dem „Schwierigen" (21) von Hofmannsthal, mit dem Lernet ja in engem Kontakt stand. Und wie für Hofmannsthal ist auch für Lernet, den angeblichen illegitimen Sohn des Erzherzogs Karl Stephan, die Atmosphäre des literarischen small talk zu einem Kürzel für die sinnentleerte Welt der Feudalaristokratie geworden.
Der Schauplatz des Romans ist so etwas wie eine Nahtstelle zwischen Ost und West, eine Art von Niemandsland, in dem aber schon die Grenzpfähle von morgen stecken, während die Akteure noch ihr einstiges Territorium abzugrenzen suchen: Ressentiments, Rachegefühle, Erinnerungen, ein nicht übersehbarer Hang zum Mystizismus und Okkultismus sind dabei die Werkzeuge dieser Hoffnungslosen. Man muß den Roman nur richtig lesen, um alsbald zu erkennen, daß man hier mehr vor sich hat als den Versuch, die Seele des Ostens im Spiegelbild der polnischen Landschaft
einzufangen, einer Landschaft, die so oft in der Geschichte von den Großmächten gemartert, mißhandelt, zerrissen, annektiert und unter Preußen, Österreich, Rußland aufgeteilt worden ist. Ihre melancholische Schönheit hatte Lernet-Holenia sich als junger Leutnant der Dragoner buchstäblich erritten, und wer dazu neigt, der mag es meinetwegen als Fügung verstehen, wenn er mitgeteilt bekommt, daß Erzherzog Karl Stephan, Lernets natürlicher Vater, vom Kaiser dazu ausersehen war, hier zu herrschen, selbstverständlich nur für den Fall, sollte Habsburg den Weltkrieg gewinnen. Das war, wie wir wissen, nicht der Fall. Dennoch nannte man den glücklosen Oberbefehlshaber
der kaiserlichen Kriegsmarine zeit seines Lebens „König von Polen", wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand.
Der erste Entwurf des „Traums in Rot" ist um die Mitte Juni 1938 zu datieren (22), gerade um jene Zeit also, da Lernet-Holenia sich mit allerlei unausgegorenen Gedanken trägt, Adolf Bartels zu klagen aber von seinem Verlag vernünftigerweise daran gehindert wird, sie in die Tat umzusetzen.
Seit ihm 1926 von Bernhard Diebold der Kleistpreis für die „Österreichische Komödie" und für „Ollapotrida" verliehen worden war, wurde Alexander Lernet-Holenia von Adolf Bartels in dessen gleichermaßen verlogener wie diffamierender Art als „Judenstämmling" angeprangert. Solange Österreich noch ein selbständiger Staat ist, kümmert sich Lernet nicht weiter darum. Nach 1938 zeitigen Bartels Denunziationen endlich die gewünschte Wirkung. Im Verlauf der „Arbeitstagung der schöngeistigen Verleger" greift die Alfred Rosenberg unterstellte Reichsstelle zur Förderung des
deutschen Schrifttums" Lernet-Holenia derart massiv an, daß die „Arbeitsfront" schließlich sämtliche Ankäufe und Ausstellungen Lernetscher Bücher in den Bibliotheken untersagt. Mit Recht fühlt Lernet sich in seiner Existenz als Autor bedroht. (22a) Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, was Bartels mit diesen Denunziationen eigentlich bezweckt. Er verfolgt damit die Absicht, einem Schriftsteller, dessen Werk er für „undeutsch" hält und dessen Laszivität in seinen Augen die Moral des Volks vergiftet, jedwede Publizität zu nehmen und damit dessen Existenzgrundlage zu untergraben.
Mit aller Entschiedenheit raten Freunde dem Dichter, die vom S.Fischer-Verlag empfohlene Strategie zu akzeptieren und davon abzusehen, Adolf Bartels auch nur mit einer Klage zu drohen. Denn der völkische Germanist hat hohe, ja höchste Freunde im Reich. So ist er erst vor nicht ganz einem Jahr, am 1.Mai 1937, von Hitler eigenhändig mit der höchsten Auszeichnung Deutschlands, dem Adlerschild mit der Widmung: „Dem deutschen Vorkämpfer für völkische Kulturerneuerung", gewürdigt worden. (23) Schon deshalb würde ihm die handschriftliche Drohgebärde in Form eines Privatbriefes wohl kaum mehr als ein mitleidiges Lächeln entlocken. Lernets Lage würde sich
jedenfalls dadurch nicht verbessem. Das könne, auch wenn er sich noch so sehr dagegen sträube, einzig und allein der „Ariernachweis". Er müsse also sofort einen erbringen, mit Daten möglichst noch hinter 1800 zurück.
Es ist daher nicht ganz verfehlt, in dem Roman „Ein Traum in Rot“ so etwas wie eine verschlüsselte Abrechnung mit dem Expansionsdrang der Nazis zu sehen, dessen Stoßrichtung in der Hauptsache nach dem Osten zielt. Seit der Annexion Österreichs durch Hitlerdeutschland ist Lernets Lebensraum keineswegs größer geworden, sondern im Gegenteil um diejenigen seiner Freunde geschrumpft, die das Land verlassen mußten. Und das sind fast alle. „Ich habe heute fast keine Freunde mehr", lautet die stehende Redewendung, die sowohl Annie Lifezis, Sándor Hartwich als auch Eduard Hebra mehrfach bezeugen. Dazu kommt, daß der erfahrene Offizier der kaiserlichen Kavallerie mit geschultem Instinkt erkennt, wie mit der Annexion eine Zangenbewegung gegen Rußland aufgebaut wird. Was ihn aber, der selbst seine Gabe an prophetischer Prognostik immer wieder unter Beweis stellt, in diesem Zusammenhang am meisten interessiert, das sind die Quatrains von Nostradamus, die erstaunliche Parallelen zum politischen Geschehen der Zeit zu haben scheinen. (24)
So war es für die in die Prophetien Eingelesenen kaum von der Hand zu weisen, daß die Zenturie III,58 bereits so etwas wie eine Zusammenfassung des Geschickes enthalten mußte, das Hitler dieser Epoche bereiten würde: Am Rhein der norischen Gebirge [also am Inn/ wird ein Großer, der zu spät gekommen ist [das heißt: ein Epigone der Romantiker], als Kind einfacher Leute geboren werden. Er wird Sarmatien verteidigen [also Polen in Schutzhaft nehmen] und die Pannonier; doch dunkel ist sein Ende. (25)
Daß der Angriff nicht aus dem Osten kommen, sondern Hitler seinerseits die Völker des Ostens überfallen würde, steht damals für Lernet ziemlich fest. Doch bleibt er mit seiner Ansicht relativ isoliert. Der Einschätzung der Rechten nach beabsichtigt Hitler lediglich die Wiedervereinigung aller „Deutschen Gebiete", also auch der Gebiete im Osten mit dem Reich. Die Stalinisten hingegen sehen die Zeit des Endkampfes herangekommen, in dessen Verlauf der Kapitalismus sich selbst zugrunderichten muß. Diese Ansicht vertritt damals auch der mit Lernet-Holenia befreundete „Rote Graf" Franz Xaver Schaffgotsch, einer der wenigen westlichen Augenzeugen der Tage unmittelbar nach der Oktoberrevolution und mit Isadora Duncan ebenso liiert wie mit Kafkas Milena Jesenská. „Hitler bedeute Krieg, lautete seine These. Die kapitalistische Welt werde sich dabei selbst zerfleischen, am Ende siege die Revolution". (25a)
Mit den wenigen ihm noch verbliebenen Freunden unterhält Lernet-Holenia in diesen Tagen einen ausgedehnten Gedankenaustausch mit dem Ziel, die berühmten Vierzeiler aus der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts zu interpretieren. Abgesehen von den frappanten und offensichtlichen Parallelen zur bisherigen Geschichte, enthalten die Quatrains eine Unzahl dunkler und geheimnisvoller Anspielungen. Diese sind oft in Zahlenfolgen versteckt und können daher nur mit Hilfe kabbalistischer Methoden entschlüsselt werden, zu denen Lernet-Holenia freilich schon seit seinem kontinuierlichen Umgang mit Persönlichkeiten aus dem Kreis um Nora Purtscher-
Wydenbruck und mit Alfred Winterstein Anfang der Zwanzigerjahre Zugang hatte.
Unverkennbar sind manche von diesen Methoden in den „Traum in Rot" eingegangen. Man erkennt sie vor allem sofort an der Atmosphäre, die sie schaffen: an diesen nicht abreißen wollenden Reden und Gegenreden, diesem unausgesetzten Grübeln, diesen endlosen Monologen, die unversehens ins Leere führen, an der Kultur des Deutens und Verwerfens, des Suchens und Versuchens, all das freilich immer wieder relativiert von der verschmitzten Ironie, ohne die kein Buch Lernets denkbar ist. Man hüte sich daher, seine Aussagen immer linear zu verstehen. Seine Bücher wollen gleichsam gegen den Strich gelesen werden. Auch das machte sie zu brauchbaren Transportmitteln für
Aussagen, die unter den Nationalsozialisten nicht ohne weiteres ausgesprochen werden durften.
Im Zentrum der zahlreichen einander überkreuzenden Erzählungen des „Traums in Rot" steht die Legende von der Geburt des Teufels, die in einem kleinen mongolischen Heiligtum auf dem Berge Bogdo-ol, umtobt von der Gegenrevolution der „Weißen", vor sich geht. Eine der umstrittensten Gestalten dieser Gegenrevolution steht an der Wiege des Teufels: der aus Graz stammende, die weißrussischen Regimenter mit einem Übermaß an Brutalität kommandierende General Roman Feodorowitsch Ungern-Sternberg, der von Ulan Bator aus für ein knappes halbes Jahr die Mongolei regierte, bis er schließlich im August 1921 von den Bolschewiken überwältigt wird.
Sein Traum von einem Ostreich der Deutschen, das stark kolonialistische Züge trägt, mag für Lernet-Holenia ein brauchbares Kürzel dafür gewesen sein, daß Aggression ausschließlich aus dem deutschen Revisionismus zu erwarten sei. Zwanzig Jahre später zieht der Teufel - er hat sich inzwischen zu einem schönen, jungen Mann mit strahlend blauen Augen ausgewachsen - gegen Westen, stiftet auf dem Gut seines Onkels Chlodowski allerhand Unheil und wird während eines Aufstandes der Volksdeutschen in Nachod in der CSR erschossen.
Der Friede scheint gerettet. So denken zumindest die Figuren des Romangeschehens. Blättert man indes wieder ein Dutzend Seiten gegen den Beginn zurück, taucht unversehens ein Datum auf, das man bei der ersten Lektüre offenbar überlesen hat: der 28. September. Der Teufel ist also am 28. September erschossen worden. Aber in welchem Jahr? Wie beiläufig hat Lernet auch das Jahr, in dem das Romangeschehen nicht nur vor sich geht, sondern in dem er den Roman auch schrieb, zwischen ausladenden Monologen versteckt. Es ist das Jahr 1938 und der 28.September der
Vorabend der Unterzeichnung des „Münchner Abkommens", für dessen Zustandekommen sich Chamberlain und Daladier von ihren Landsleuten als Sicherer des Friedens begeistert feiern ließen. Für Lernet-Holenia dagegen schien die Kriegsgefahr noch keineswegs gebannt.
Nur wenige Tage nach dem Münchner Abkommen" gibt er nämlich dem langjährigen Freunde, Eduard Hebra, Anweisungen für den Fall, daß es in absehbarer Zukunft zu übergreifenden Konflikten käme, die er nicht überleben würde.(26) Er erkrankt an einer eitrigen Angina, bestreitet aber den Freunden gegenüber, daß diese Krankheit in irgendeinem Zusammenhang mit den Ereignissen der Zeit stehe, die ja jetzt - wer weiß wie lang, wer könne das Ende absehen - immer so oder vielleicht noch schlimmer weitergehen würden.(27) In seinen Briefen ist er vorsichtiger, redet um den Brei herum, gebraucht doppelte, ja dreifache Verneinungen. Denn mittlerweile hat es sich auch unter den Zensoren herumgesprochen, daß man damals in Briefen zu negieren beginnt, was betont werden soll und umgekehrt. Zu dieser Zeit etwa eignet er sich auch die Marotte an, seine Briefe mit weit hergeholten Namen aus der spanischen und der französischen Geistesgeschichte zu unterzeichnen, was im Ernstfall von geringem Nutzen gewesen wäre. Denn sowohl Lernets einlangende wie auch seine abgehende Post wurde laut Auskunft der Gemeinde St. Wolfgang während der NS-Zeit überwacht. (28)
Zieht man all das in Betracht, so wird man es gewiß nicht als Zufall qualifizieren, wenn Lernet-Holenia die Intimbotschaft des „Traums in Rot" ausgerechnet den drei Mongolenfürsten in den Mund legt, die den Teufel besuchen. Sie haben seinerzeit unter Ungern-Sternberg, also für die Weißgardisten, gekämpft, aber seitdem erkannt, daß der von ihm beabsichtigte Weg, Asien zu europäisieren, falsch gewesen ist. Für sie ist Europa gar nicht so wichtig, wie Ungern-Sternberg geglaubt hat. Es klingt beinahe wie eine Drohung oder doch zumindest wie eine prophetische Warnung, wenn sie ihren Besuch selbstsicher abschließen: Jeder von uns ist stark, stärker als die Menschen, die im Westen wohnen, denn in jedem von uns waltet die Kraft der unendlichen Erde Asiens, das die Wiege der Völker ist.(29)
3. Karibisches Zwischenspiel
Man wird heute, wo es doch bei weitem mit weniger Risiko verbunden ist, unbequeme, brisante politische Thesen zu vertreten, lange suchen müssen, um einen Verleger mit vergleichbarer Courage zu finden. Denn ausgerechnet zu der Zeit, da S.Fischer das Manuskript des „Traums in Rot" in Satz gibt, besteigt Lernet-Holenia kurz nach Neujahr 1939 in Hamburg die M.S.Milwaukee der Hamburg-Amerika-Linie. Mit an Bord hat er eine Abschrift des „Traums" genommen, weil er hofft, damit in Hollywood landen zu können. Zuvor, nämlich am 4.1.1939, hat er noch eine Besprechung wegen eines neuen Films mit Carl Froelich in Berlin, der bei der Verfilmung von Lernets Roman „Ich war Jack Mortimer" seinerzeit Regie geführt hat. (29a)
Tags darauf verhandelt er mit seinem Verleger wegen der allfälligen Vergabe von Filmrechten in die Vereinigten Staaten. Auch interessieren sich Pearn, Pollinger & Higham, London, für die Rechte einer Übersetzung des „Mannes im Hut" sowie für die Übernahme einer englischen Ausgabe der „Standarte" von Heinemann, der seine Rechte bis dahin nicht in Anspruch genommen hat. Beide Projekte werden einstweilen als politisch inopportun aufs Eis gelegt. Am Abend des 7. Jänner ist Lernet zu einer Party ins Haus seines Verlegers geladen. Bevor noch andere Besucher an Aufbruch denken, empfiehlt er sich heimlich, um den Nachtzug nach Hamburg nicht zu versäumen. Am 8.
Jänner geht er an Bord der M.S.Milwaukee. Lernet hat also Europa ohne Abschied verlassen. Man könnte somit auch bei ihm einen tiefen Einschnitt der Lebenskontinuität erwarten. Doch obzwar Freunde von Emigrationsplänen zu berichten wissen, die bereits konkretere Gestalt angenommen haben sollen, wird alles anders kommen.(30)
Mehr als fünf Wochen kreuzt Lernet-Holenia in der Karibik. Als die Milwaukee am 14.2.1939 in den Hafen von New York einläuft, erwarten ihn bereits Lily Sporer, seine langjährige Freundin, die Regisseure Fritz Kortner, Albrecht Joseph und Franz Horch, mit denen Lernet schon seit den Zwanzigerjahren befreundet ist. Sie lesen das Manuskript des „Traums in Rot", loben es als Roman, geben aber zu verstehen, daß man daraus kaum einen Film machen könne, der in Amerika Erfolg haben würde.
Als Lemet schließlich sieht, in welch erbärmlicher Kammer am „Riverside Drive" die früher mondäne Lily als Emigrantin hausen muß, beginnt er, sich immer entschiedener den Versuchen der Freunde zu widersetzen, ihn zum Bleiben zu überreden. Er ist unfähig sich vorzustellen, eine Existenz ohne die ihm vertraglich zugesicherte Summe in einem Land wie den Vereinigten Staaten neu aufzubauen, dessen Lebensformen ihm von Grund auf zuwider sind. Wie sehr, das wird er später dem Erzähler des Romanes „Die Inseln unter dem Winde" in den Mund legen: Das also war die Mitte der Welt... diese gebietende Kulisse, hinter der, wie hinter den großartigen Kulissen so und so vieler andrer amerikanischer Hafenstädte, das wirkliche Leben genau so banal und ärmlich und elend sein konnte wie im kleinsten Dorf, nur vielleicht noch ein wenig banaler, ärmlicher und elender. (31)
Gewiß schwingt mit solcher Verurteilung in al fresco-Manier auch die Erfahrung mit, die Lernet erst knapp zehn Jahre später machen wird, daß die Flucht über den „Großen Teich" nicht notwendig allen Rettungsuchenden Rettung brachte. Erschüttert erfährt er erst geraume Zeit nach dem Krieg, daß Lily Sporer in bitterster Armut gestorben ist. In der Rückschau mag man es daher vielleicht für Zweckoptimismus halten, wenn Lernet seinen Freunden damals erklärt, der festen Überzeugung zu sein, daß der Spuk mit Hitler ohnehin in wenigen Monaten zu Ende sein würde. Wie eine der zwielichtigen Prophezeiungen aus einem seiner Romane berührt hingegen die Antwort, die er auf Lilys Bitten gibt, doch bei ihr in New York zu bleiben: Er werde gehen, denn niemand könne seinem Schicksal wirklich entrinnen.
Diesen Fatalismus der Stoa wird Lernet im übrigen in einigen seiner Arbeiten, am überzeugendsten vielleicht in dem Roman „Die Inseln unter dem Winde" gestalten, deren Landschaften er im Verlauf der Kreuzfahrt kennengelernt hat. Am 18. Februar 1939 läuft die Milwaukee wieder Richtung Europa aus. Zurück bleiben nicht nur die Freunde, die bereits vor knapp einem Jahr nach New York emigriert sind, sondern auch vier befreundete Ehepaare, die mit Lernet gekommen sind, weil die Urlaubsreise ihnen unauffällige Gelegenheit geboten hat, ihre besetzte Heimat zu verlassen. Sie alle erklären eine Rückkehr für die dümmste, aber gefährlichste seiner Allüren. Doch Lernet beharrt auf seinem Standpunkt. Anfang März ist er bereits wieder in Wien und anschließend in Hochrotherd, im Haus von Charlotte Sweceny, (32) Sofort nach der Ankunft betreibt er mit großem Eifer die Korrekturen zum „Traum in Rot", weil er, wie Hebra mitteilt, besorgt ist, das Buch könne nicht rechtzeitig erscheinen. Als Hebra um eine genauere Erklärung des etwas dunklen Satzes ersucht, soll Lernet gesagt haben: Das politische Geschehen könne es sonst noch überrollen (33), was nur soviel heißen kann wie: der in Lernets Roman erschossene Teufel würde vielleicht unversehens doch wieder zum Leben erwachen.
4. Glastüren
Während seiner Abwesenheit hat es Lernets Schauspiel „Glastüren" (34), eine beschwingt- laszive Komödie ohne Tiefgang, Mitte Februar 1939 in Wien und einen Monat danach in Berlin zu einem mittleren Theaterskandal gebracht. In vorauseilendem Gehorsam fühlen sich manche Kritiker bemüßigt darauf hinzuweisen, daß Lernet wegen einiger Frivolitäten in seiner Erzählung „Strahlenheim" vom „Schwarzen Korps" schärfstens zur Ordnung gerufen worden ist (35) Genauer gesagt, handelt es sich dabei um eine freilich überaus delikat dargestellte Deflorationsszene (36), an der heute kaum jemand Anstoß nehmen würde. Es gehört eben mit zur Symptomatik militanter Herrschaftsideologien, sich über die Befreiung des weiblichen Körpers und der weiblichen Sexualität zu empören, zumal solange man daran nicht selbst beteiligt ist, im übrigen aber diskret darüber hinwegzusehen und zu schweigen, wenn Millionen und Abermillionen menschlicher Körper gemartert oder gemordet werden.
Dieses Exempel, das die SS an Lernets Buch wie auch in zunehmendem Maße an den Büchern anderer nicht systemkonformer Autoren statuiert, entspringt dem nach und nach immer deutlicher hervortretenden Anspruch der „Schutzstaffeln", alleinige Hüter der wahren und reinen nationalsozialistischen Lehre zu sein. Aus solchem Blickwinkel mag daher eine gewisse Logik darin erkannt werden, wenn die Redaktion des »Schwarzen Korps" in Lernets leichtgewichtigem Sommerroman so etwas wie den Versuch zu orten vermeint, Geschmack und Moral des deutschen Bürgers zu untergraben, zu zersetzen. Denn Herrschaft gründet nicht zuletzt auf die Beherrschung
von Sexualität. Keine Organisation hat das jemals besser zu handhaben gewußt als die katholische Kirche. (37)
Für den „Völkischen Beobachter" sind die „Glastüren" der willkommene Anlaß, sich in einer zweispaltigen Glosse mit der Morbidität ihres Autors auseinanderzusetzen. Hollywood darf darin ebenso wenig fehlen wie die „Dunkelmänner", denn es ist ein Schuß vor den Bug, der belegen soll, wie solid die Gestapo auch im Ausland, zumal in den Vereinigten Staaten, arbeitet. Schon die wenigen Sätze im Auszug lassen das einheitliche Muster erkennen, das dahinter steckt: „Wieviel Unheil wird dieses Stück wieder anrichten! [...] Volksfremde haben diesen genußsüchtigen Nichtstuer, träumenden Traumichnicht, witzigen Hohlkopf und liebenswürdigen Unverbindlichen entdeckt, aufgepäppelt und nun der ganzen Welt in Romanen, Bühnenstücken und Filmen serviert. Die Grinzing-Perspektive Hollywoods hat sich in den Hirnen aller jener festgesetzt, die von der wahren Ostmark des Reiches und ihren Menschen nichts wissen oder nichts wissen wollen. Indem man einen oberflächlich schillernden Österreicher als verführerisch und verlockend darstellte,
sollte die nationale Kraft des Österreichers abgewürgt werden. Die dunklen Mächte, denen dies diente, haben wir bis vor einem Jahr zur Genüge kennengelernt. "(38)
Auch Goebbels besucht das Gastspiel des, Theaters in der Josefstadt" in den Berliner Kammerspielen am 25.3.1939. In seinem Amtsbereich liegen mehrere Faszikel mit Gutachten über den Schriftsteller Lernet-Holenia. Vom Beginn der „Bewegung" an steht für die Nationalsozialisten der, frivole Zynismus“ des Erfolgsautors in engster Nachbarschaft zum, wie es in deren Jargon heißt, „zersetzenden Ungeist jüdischer Rationalität'. Nichts Gutes läßt bereits 1928 der Hinweis von Adolf Bartels ahnen. Später bestätigen das aber neben anonymen Glossen immer wieder Aktenstücke, die Lernets Weg als Schriftsteller nicht gerade fördernd begleiten. In einer Stellungnahme des „Kulturpolitischen Archivs" heißt es bereits 1935 in prächtigem Deutsch: „Abgesehen von seiner rassischen Herkunft ist Lernet-Holenia jedoch eine Persönlichkeit, die auf Grund ihrer geistigen Erzeugnisse ebenso abzulehnen ist als wenn nichtarische Herkunft vorläge. Sowohl 'Ljubas Zobel', 'Die Österreichische Komödie', 'Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen' als auch 'Jo und der Herr zu Pferde' sind für nationalsozialistisches Publikum untragbar. Die zuständigen Parteistellen lehnen Lernet-Holenia ab."(39)
Aber noch sieben Jahre danach hat das Verständnis des von Alfred Rosenberg geleiteten Amtes keineswegs zugenommen. Nach wie vor mißtraut man einem Schriftsteller, der sich über die Verlogenheit herkömmlicher Moral ebenso lustig macht wie über den Glauben an falsche Autoritäten. Daß dies in einer charmanten, breite Kreise ansprechenden Art geschieht, macht die Sache nur noch schlimmer. Man wirft ihm „Vielschreiberei" vor, „Mangel an dichterischer Echtheit", an ,,Verantwortungsgefühl" und versucht, dem Zyniker jeden Zugang zu derart selbstverständlichen und für einen Schriftsteller notwendigen Werbestrategien wie Dichterlesungen und Vorträgen zu verwehren: „An die Reichsdienststelle Deutsches Volksbildungswerk, Hauptabt. III/Vortragswesen, 3/Dichterlesungen. Die Heranziehung Lernet-Holenias zu Lesungen aus seinen Werken im Deutschen Volksbildungswerk ist nicht zu empfehlen. [...] Auch der zuständige Hoheitsträger erhebt Einspruch gegen seinen Einsatz. Gezeichnet Dr.Killer (Reichshauptstellenleiter)."40 Reichsminister Dr. Goebbels, der, wie gesagt, der Berliner Erstaufführung der Komödie „Glastüren" beiwohnt, preßt die ablehnende Haltung der Partei in zwei knappe Sätze: "Ein ganz schwaches, morbides Stück von Lernet-Holenia. Aber glänzend gespielt." (41)
5. Mars im Widder
Am 4. August 1939 erscheint endlich „Ein Traum in Rot". Am 15. August wird Lernet zum 7.Kavallerie Schützenregiment einberufen. Am 1. September verkündet Hitler mit den Worten: „Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen" den Beginn des Überfalls auf Polen. Am 2. September wird Lernet bei Rabka an der Hand verwundet. Er hat einen sogenannten Tausendguldenschuß, also eine relativ leichte Verwundung abbekommen, bleibt zunächst im Lazarett bei der Truppe und erhält schließlich Genesungs- und Heimaturlaub. Am 15. Dezember beginnt er, einen Roman zu schreiben, dem er den
Titel „Die blaue Stunde" gibt und der nach seiner Fertigstellung am 15. Februar 1940 von Chefredakteur Ludwig Reindl und Paul Wiegler für einen Vorabdruck in der Zeitschrift „Die Dame" in Aussicht genommen wird. Dieser Vorabdruck wird später großes Aufsehen erregen, weil es sich dabei um die erste Darstellung des Kriegsgeschehens rund um den Überfall auf Polen in Romanform handelt. Vermutlich sind diese starke Beachtung seitens des Publikums ebenso wie die Titeländerung dafür verantwortlich zu machen, daß sich das „Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda" später eingehend mit der Buchfassung auseinandersetzen wird.
„Und dabei habe ich doch ganz genau beschrieben, was ich erlebt habe. Alles hat sich genauso abgespielt, auch meine Verwundung", feierte Lernet, als ich ihn nach einer Sitzung des P.E.N.-Clubs Mitte der Sechzigerjahre nach Hause begleitete, schmunzelnd den Sieg des Realismus über den Totalitarismus.42 Genau dieser Realismus aber sollte seinem Buch noch zum Verhängnis werden. Ich kann es mir an dieser Stelle umso leichter versagen, detailliert auf die zahlreichen Facetten der „Blauen Stunde" einzugehen, als eine eingehende, in diesem Band gedruckte Untersuchung von Robert von Dassanowsky vorliegt, in der dieser Roman als Buch des österreichischen Widerstands gefeiert wird. Dem ist, außer einigen bisher weniger klar anvisierten Gesichtspunkten, nichts Wesentliches hinzuzufügen.
Als das Buch 1947, sechs Jahre nach seinem Entstehen, bei Bermann-Fischer zu Stockholm endlich in gebundener Form erscheinen kann, heben die meisten Kritiker den seither legendär gewordenen „Zug der Krebse" als ein Meisterwerk verdeckter Agitation hervor. Während Wallmoden, der Held des Buches, am Vorabend des Überfalls auf Polen das Gelände entlang der Grenze durchstreift, hört er ein Scharren, Schaben und Schleifen, ein eigentlich metallisches Geräusch, nur leiser, gedämpfter,
verhaltener, das über die Brücke herkommt und sich diesseits in den Wiesen verliert. Näher hinzutretend erkennt Wallmoden Krebse, die auf der Flucht sind und die mit ihrem Rückzug auf ein Ereignis vorausdeuten, das erst sechs Jahre später Realität werden wird: auf die Vertreibung und chaotische Flucht des deutschen Heeres aus den besetzten und ausgebeuteten Ostgebieten.
Was mich jedoch an diesem Roman weit mehr interessiert als diese unheimliche und prophetische Passage, das ist der Mut, mit dem Lernet-Holenia Lügen Hitlers schon in der NS-Zeit entlarvt. Rechnet man die abgelaufene Romanzeit nach - und Lernet sorgt durch einige Fixpunkte dafür, daß einem das ohne allzugroße Mühe gelingt -, so muß sofort klar werden, über welch langen Zeitraum sowohl die Planung als auch die Vorbereitung des vorgeblichen „Vergeltungsschlags" gegen Polen sich erstrecken. Um hier nur den eigentlichen Aufmarsch zu erwähnen. Schon am 20. August 1939 bewegt Wallmodens Regiment sich nordostwärts, am 23.8. wird - man ist jetzt unweit der polnischen Grenze - scharfe Munition ausgegeben, am 27.8. ist der Aufmarsch des Regiments beendet, am 29.8. wird die Beschießung des Dorfes Tschysne besprochen, am 1.9.1939 ist schließlich die Aufstellung der Schwadronen vollzogen. All das ist in dem Roman festgehalten, der noch während der Tage des „Dritten Reiches" als Vorabdruck in der Zeitschrift „Die Dame" erscheint. (43) Aber es kommt noch deutlicher. Ich zitiere aus dem Text des Romans: „Er sah, links der Straße, Schützenrudel hervorhuschen, er sah sie, schattengrau, durch das morgendliche Silbergrün der Wiese laufen... Es war, auf Wallmodens Uhr, noch nicht ganz dreiviertel fünf. Er war noch an die Exaktheit des Hervorbrechens von Angriffen gewöhnt, die mit Trommelfeuer vorbereitet gewesen waren. Er wartete jeden Augenblick, die Vorwärtsschwärmenden in die Garben von Maschinengewehrfeuer geraten zu sehen. Aber es geschah nichts dergleichen. Auch seine eigene Schwadron erhob sich nun und lief, mit einem vielfältigen Klappern und Rauschen der Waffen und Geräte, über die Wiese und gegen den Fluß. Wallmoden lief, so schnell er konnte, denn er war sicher, daß längs des ganzen gegenüberliegenden Hanges prasselndes Feuer beginnen müsse. Aber es fiel kein einziger Schuß... Es war alles anders gekommen, als er erwartet hatte. Die Zeit hatte begonnen, zu der alles anders kommen sollte. “ (44)
Fassen wir das Gesagte hier noch kurz zusammen, bevor wir Schlüsse daraus ziehen: Zwei Erzählhaltungen stehen in diesem Roman dicht nebeneinander und bilden den kryptischen Kern seiner Botschaft. Es ist die poetische, stark metaphorische Schilderung des Zuges der Krebse, die eher verbirgt als den Sachzusammenhang entschleiert. Und dann der mit großer Präzision geschilderte Aufmarsch mit seinem militärischen Umfeld und dem dazugehörigen Jargon. Wieso kann Lernet sich einerseits eine derart offene Sprache leisten und andererseits nur wenige Seiten später es für ratsam erachten, sich einer verdeckten Schreibweise zu bedienen? Die Antwort auf
diese Frage liegt in der verschiedenen Gewichtung der durch die Abschnitte transportierten Inhalte. Hätte der in die Deutsche Wehrmacht als Reserveoffizier einberufene Autor seine Vision von der überstürzten Flucht des Heeres aus den Ostgebieten offen mit deren eben erst anrollender Invasion in Verbindung gebracht, er wäre wegen „Wehrkraftzersetzung" von einem Militärgericht dafür ohne Zweifel zum Tod verurteilt worden.
Demgegenüber findet das „Oberkommando der Wehrmacht", das in erster Instanz für die Erteilung der „Druckerlaubnis für Manuskripte von Offizieren"45 zuständig ist, an dem von Lernet-Holenia dargestellten Aufmarsch vor allem deswegen nichts auszusetzen, weil dieser den hier, in dieser Instanz, ohnehin sattsam bekannten Abläufen entspricht. Um jedoch ganz sicher zu gehen, schlagen Ludwig Reindl und sein Redakteur Paul Wiegler Kürzungen und gewisse Veränderungen des Romananfangs vor. Zunächst steht Lernet dem ganzen Projekt, vor allem aber den vorgeschlagenen Kürzungen höchst ablehnend gegenüber. Schließlich geben aber zwei Gesichtspunkte den Ausschlag, die von Wiegler für eine Veröffentlichung in der „Dame" eingestrichene Fassung teilweise zu akzeptieren: Erstens hat Goebbels soeben die Aufnahme von Lernets Roman „Ein Traum in Rot" ins „Buch des Jahres" verboten. Das bedeutet praktisch so viel wie einen Stopp aller Rezensionen und in weiterer Folge die nicht unerhebliche Minderung an Einkünften.
Sodann läuft Lernets Enthebung vom aktiven Militärdienst schon mit Jahresende wieder aus. Um sie zu verlängem, braucht er drei Nachweise, daß seine Tätigkeit im öffentlichen Interesse liege. Es gelingt Lernet, sich nicht nur die Befürwortung der Zeitschrift „Die Wehrmacht" zu beschaffen, die bereits im April 1940 ansucht, ihn für das Romanprojekt „Beide Sizilien" u.k. zu stellen, sondern auch die Bestätigung der „Wien-Film", mit der Lernet seit Jahren zusammenarbeitet. Kurz und gut: Der Vorabdruck des „Mars im Widder" käme daher überaus gelegen, um auch den dritten der erforderlichen Anträge, nämlich den des „Deutschen Verlages" zu untermauem und plausibel abzustützen.(46) Im Juli 1940 passiert „Die blaue Stunde" anstandslos die Zensurstelle der Wehrmacht (47), und Chefredakteur Ludwig Reindl hält es daher, obwohl die Dienstanweisung das vorsieht, nicht mehr für erforderlich, das Manuskript auch noch dem „Reichsministerium" vorzulegen. Doch wünscht er sich einen neuen Titel. Der gegenwärtige scheint ihm zu wenig zugkräftig, zu wenig griffig. Auch seien bereits mehrere Bücher mit diesem oder einem ähnlichen Titel auf den Markt gekommen.
In der ihm eigenen Querköpfigkeit gibt Lernet-Holenia dem Buch schließlich den neuen Titel: „Mars im Widder". Querköpfigkeit deswegen, weil dieser Titel von jedem mit Astrologie auch nur einigermaßen Vertrauten als siderische Konstellation des unausweichlich drohenden Krieges verstanden werden muß. Gewiß, hinter dem zunächst vom Autor vorgeschlagenen Titel, „Die blaue Stunde", würde jeder Zensor eher eine jener skurrilen Liebesgeschichten vermuten, wie sie Lemets Werk in zahlreichen Varianten durchziehen, als die subversive Auseinandersetzung um den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und doch markiert auch hier eine Liebesgeschichte die Koordinaten
des Geschehens. Allerdings dient sie der transportierten Botschaft als Camouflage, ohne jedoch selbst einzige und ausschließliche Botschaft zu sein.
Mitte September 1940 erhält Lernet die Verlängerung seiner Freistellung vom Militär. Einen Monat darauf beginnt mit großem Erfolg der Vorabdruck von „Mars im Widder". (48) Wie schon beim „Traum in Rot" versucht Lernet, Satz und Druck der Buchausgabe zu beschleunigen. Doch wird er vom S.Fischer-Verlag, der offenbar eine Art von Hinhaltetaktik betreibt, immer wieder mit der Erklärung abgespeist, daß alle Berliner Setzereien ausgebucht seien. Daraufhin greift Lernet zur Selbsthilfe und versucht, den Auftrag der Buchdruckerei Manz in Wien zuzuspielen. Offenbar befürchtet er das Hereinbrechen irgendwelcher „forces majeures", wie Charlotte Sweceny, die mit Lernet befreundete Mitbesitzerin des Manzschen Verlagshauses, vermutet.(49) Überraschend schnell, nämlich Anfang Februar, beginnt jetzt der Satz des ,,Mars im Widder", und schon am 29.4.1941 gibt das „Oberkommando der Wehrmacht" die Buchfassung frei. Es existiert noch heute eine Titelei», auf der diese Freigabe vermerkt ist, unterschrieben vom Leiter der Gruppe III, Dr. Scheidt, Abteilung Inland des OKW. Auf Grund dieser Freigabe läßt der S.Fischer-Verlag in erster Auflage 15.000 Exemplare drucken und binden. Doch wird es nicht mehr zur Auslieferung kommen. Durch den neuen Titel aufmerksam gemacht, befaßt sich das „Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda" eingehend mit dem neuen Buch des nicht erst seit dem „Traum in Rot" in Mißkredit geratenen Autors. Es erkennt, daß hier geradezu die Chronologie eines Angriffskrieges nachgezeichnet und Hitlers Darstellung der Ereignisse Lügen gestraft wird. Ganz abgesehen davon, daß nicht einmal die Uhrzeit des Angriffes stimmt, die Hitler am 1.9.1939 um 10 Uhr dem Reichstag auftischt: „Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen". Er trägt bei diesem Anlaß eine einfache feldgraue Uniform, die er bis zum Sieg zu tragen schwört. Aber geschossen hat die Deutsche Wehrmacht, wie wir heute wissen und der Augenzeuge Lernet-Holenia immerhin schon 1940/41 festgehalten hat, nicht erst seit 5 Uhr 45, sondern bereits um eine volle Stunde früher.
Die oben vorgestellte Stelle aus „Mars im Widder" macht aber noch etwas anderes deutlich: wie unerwartet Hitlers Überfall die Polen getroffen haben muß. Kein Sperrfeuer, nicht einmal ein vereinzelter Schuß empfängt die mit erheblichem Klappern und Klirren ihrer Ausrüstungen in das fremde Staatsgebiet eindringenden deutschen Soldaten. „Aber es geschah nichts dergleichen," berichtet der Erzähler lakonisch, um den Leser darauf aufmerksam zu machen, daß nicht die Polen im Begriff sind, das Hoheitsgebiet Deutschlands zu verletzen, sondern umgekehrt die Deutschen es sind, die das unvorbereitete Polen überfallen. Und schließlich, eindringlicher, suggestiver
noch der Hinweis: „aber es fiel kein einziger Schuß". Ein Satz, der wie der Versuch des Erzählers anmutet, den Leser ja nicht darüber hinweglesen zu lassen, daß der polnische Grenzschutz offenbar auf seinen Pritschen überrascht worden ist, was der Großteil des deutschen Volkes freilich erst nach dem Krieg erfahren wird.
Selbstverständlich muß diese für die Nationalsozialisten doch recht peinliche Korrektur ihrer Geschichtsfälschung unterbunden werden, will die Regierung nicht Gefahr laufen, ihre politische Glaubwürdigkeit nach innen wie nach außen einzubüßen. Denn immerhin ist Alexander Lernet-Holenia ein nicht nur im deutschen Sprachraum anerkannter Schriftsteller, sondern weit mehr noch als das: Er ist Augenzeuge des „Polenfeldzugs" und damit jemand, der ein Stück Geschichte dokumentiert und aufgeschrieben hat. Geschickt war es Reindl und Wiegler gelungen, die
Zeitschriftenfassung von „Mars im Widder" unter Mithilfe des Dr. Scheidt vom OKW, Abteilung Inland, Gruppe III, an der dafür zuständigen Stelle des Propagandaministeriums vorbeizuspielen. Doch jetzt, wo es um die ungekürzte Buchfassung geht, hebt ein Tauziehen zwischen dem S.Fischer-Verlag, der Zensurstelle der Wehrmacht und den politischen Instanzen des Propagandaministeriums um die
Erlaubnis zur Buchpublikation an. Denn immerhin geht es nicht um den militärischen Aspekt allein, sondern, weit heikler noch, um den politischen. Deshalb und weil der Stellenplan ausdrücklich das Zusammenwirken von OKW und Propagandaministerium bei der Erteilung der Druckerlaubnis für Manuskripte von Offizieren" vorschreibt, findet schließlich der ganze „Fall" ein unerwartetes Ende.
Um den 15. April 1941 ist das Buch inzwischen bereits ausgedruckt und am 29. April, wie gesagt, von der Wehrmacht freigegeben worden. Sogleich nach der Freigabe schaltet sich Goebbels' Ministerium massiv ein, um die Auslieferung des „Mars im Widder" zu verhindern. Doch vermag es die Freigabe zunächst nicht ohne weiteres rückgängig zu machen, da sie in einer fremden Sachkompetenz ausgesprochen worden ist. Als entscheidend für den ganzen Vorgang, der von Mitte Juni bis 20. Juli dauert, erweist sich schließlich allein die Stellungnahme von General Major Günther Ziegler,
dem Leiter der Abteilung Inland im OKW.
Ziegler, ein treuer Gefolgsmann Hitlers, noch aus den Tagen vor der „Machtergreifung" Pilot des „Führers", ständiger Begleiter bei dessen Flügen innerhalb Deutschlands, Mitglied des Reichstages und gegen Ende des Krieges „Wehrwirtschaftsführer und Rüstungsinspektor Ukraine, Kaukasus und Ostland" (51), gibt schließlich der Intervention statt und untersagt das Erscheinen des Romans. Auf dringendes Ersuchen Lernets, die Bücher nicht einzustampfen, versteckt der Verlag die gesamte Auflage, doch verbrennt sie im Verlauf des schweren Luftangriffes am Morgen des 3. Dezember 1943 in einem Lager des Verlages bei Leipzig. Abgesehen von dem gekürzten Vorabdruck in der
Zeitschrift „Die Dame" bleibt lediglich ein einzelnes Exemplar, das sogenannte „Vorausexemplar“ , das sich bereits im Besitz des Autors befindet, erhalten. So kann man denn ohne Übertreibung sagen, das in der NS-Zeit nicht ausgelieferte Buch hat dennoch einige Wirkung gezeitigt.(52)
6. Abschließendes
Damit komme ich zum Schluß der Darstellung derjenigen Romane Lernet-Holenias, die den Nationalsozialismus und seine Ideologie zur Zielscheibe ihres Spottes machen. Zu den wichtigsten architektonischen Elementen seiner Romane gehört - ganz allgemein gesprochen - zumeist eine gewisse labyrinthische Anlage des Handlungsgefüges. In das vordergründig durchaus realistisch Erzählte sind oft blinde Gänge eingeschrieben, die unversehens ins Leere oder in die Tiefe führen und so im Leser nicht selten Zweifel an der 'Tragfähigkeit der Oberflächenrealität aufkommen lassen, aufkommen lassen sollen. Doch darf man sich davon nicht täuschen lassen. Nichts liegt Lernet-Holenia ferner als jenes Obskurantentum, wie es die Zwanziger- und Dreißigerjahre als Unterströmung zur Neuen Sachlichkeit" durchzog. Für ihn sind die großen wie die kleinen Überraschungseffekte, die das Irrationale bietet, nichts anderes als Köder. Die Grundhaltung seiner Persönlichkeit als Dichter ist vielmehr die alles, selbst ihren eigenen Standort infrage stellende Ironie der österreichischen Aufklärung, wie sie noch im Wiener Volkstheater des 19. Jahrhunderts aufblitzt. Und das ist sicher nicht zu weithergeholt.
Man werfe nur einen Blick in eines der dreiundreißig seiner Theaterstücke, etwa in „Die österreichische Komödie", in „Glastüren" oder in „Ollapotrida" (53), dann wird man diese unmittelbare Nachbarschaft zum handfest derben Theater des Volkes selbst dort und gerade dort noch erkennen, wo sie in die Eleganz des Konversationstons der „höheren Schichten" verpackt ist. Gewiß, der Roman hat eigene, vom Theater sich gänzlich abhebende Strukturgesetze: Darum folgt hier keineswegs Pointe auf Pointe, die Ironie dem Fehlverhalten nicht auf dem Fuß. Sie gehört vielmehr zur Disposition des Buches, und so wird der sich oft über Hunderte von Seiten spannende Bogen von manchem Leser erst in der Rückschau oder erst nach der zweiten Lektüre erkannt werden.
Das gilt vor allem für Botschaften oder für Stellen, worin Ideologien oder Glaubenswerte des „Dritten Reiches" glossiert werden. Im übrigen fällt auf, daß alle in der NS-Zeit veröffentlichten Bücher Lernets, der gewohnt war, seine Arbeiten stets zu diktieren, präziser, prägnanter, besser durchkomponiert sind, kurz, untrügliche Spuren genauerer Korrekturen aufweisen als alle seine Bücher davor und danach. Denn so wenig man es in der NS-Zeit wagen durfte, Kritik am Regime anders als mit verdeckter Metaphorik zu transportieren - und das gilt selbst für Privatbriefe -, so verhängnisvoll wäre eine saloppe Formulierung gewesen, die den Zensor die wahren Absichten des Autors hätte erkennen lassen.
Lernets an Rilke und dem frühen Benn geschultes Vermögen zu bedeutungsdurchlässigem, vieldeutigem Ausdruck war den drei Romanen, in die er Kritik an der NS-Ideologie verpackt hatte, entgegengekommen. All das macht es nicht leicht, Alexander Lernet-Holenia mit dem unscharfen Begriff ,Innere Emigration" zusammenzusehen. Er ist zu keiner Zeit Duckmäuser oder gar Mitläufer gewesen. Er versucht vielmehr innerhalb der Grenzen des gerade noch Artikulierbaren zu sagen, was
gegen ein entmenschtes, von falschen und inhumanen Ideologien zersetztes Regime zu sagen ist. Mit den ihm erreichbaren, von ihm beherrschten Mitteln leistet er Widerstand. Denn wie die Autoren des Wiener Volkstheaters versteht er die Kunst der subversiven Anspielung. Während andere längst verstummt sind, betreibt er Ideenschmuggel, aber für all jene, die lesen können, schreibt er eine eindeutige Sprache.
Eine Anekdote, die all das, vor allem aber Lernets allzeit verfügbare Dialektik, seine Fähigkeit, den doppelten Boden von Sprache schlagartig aufbrechen zu lassen, gut charakterisiert. „Im Sommer 1944", so berichtete der bereits mehrfach zu Wort gekommene Jugendfreund Eduard Hebra, dessen Bruder von den Nationalsozialisten hingerichtet worden war, ,,saßen Lernet und ich in einem Gasthausgarten in St.Wolfgang. Da sagte Lernet mit seiner tragenden Stimme: „Es ist ein wahres Glück, daß wir unseren Führer haben; sonst würde der Krieg noch weitere fünf Jahre dauern". (54)
Anmerkungen:
1. Mitgeteilt von Annie Lifezis, Bad Vöslau, am 6. Juli 1979.
2. Albrecht Joseph: Aufzeichnungen über Alexander Lemet-Holenia, Xeroxkopie des
Typoskriptes: Archiv Dr.Rocek.
3. Vgl. dazu Verf.: Vorwort zu Alexander Lemet-Holenia: Das lyrische Gesamtwerk,
Wien-Darmstadt: Paul Zsolnay 1989, 14 ff.
4. Albrecht Joseph: a.a.O.
5. Mitgeteilt von Alexander Lernet-Holenia, Wien, am 18.Mai 1962.
6. Alexander Lernet-Holenia: Monologische Kunst? Ein Briefwechsel zwischen
Alexander Lernet-Holenia und Gottfried Benn. Wiesbaden: Limes 1953.
7. Vgl. dazu: Anmerkung 3, 9.
8. Hilde Spiel: Alexander Lemet-Holenia. Zu seinem 60.Geburtstag, in: Der Monat
12(1957), Nr. 109, 69.
9. Vgl .dazu: Marie von Ebner-Eschenbach: Aus Franzensbad. Sechs Episteln von
keinern Propheten. Leipzig: Theile 1858.
10. Hilde Spiel: a.a.O., 67.
11. Äußerung von Alexander Lemet-Holenia, mitgeteilt von Annie Lifezis, Bad Vöslau,
am 6.Juli 1979, Archiv Dr.Rocek.
12. Alexander Lernet-Holenia: Der Mann im Hut. Berlin: S.Fischer 1937.
13. Karl Kraus: Beim Wort genommen, München: Kösel 1955, 224.
14. Alexander Lernet-Holenia: Der Mann im Hut, a.a.O., 119.
15. Alexander Lernet-Holenia: ebenda, 120.
16. Alexander Lernet-Holenia: ebenda, 124.
17. Alexander Lernet-Holenia: ebenda, 296.
18. Alexander Lernet-Holenia: ebenda, 34lf.
19. Alexander Lernet-Holenia: Ein Traum in Rot. Berlin: S.Fischer 1939.
20. Alexander Lernet-Holenia: Österreichische Komödie. Berlin: S.Fischer 1927.
21. Hugo von Hofmannsthal: Der Schwierige. Lustspiel in drei Akten. Berlin:
S.Fischer, 1921
22. Mitgeteilt von Alexander Lemet-Holenia, Wien, am 6.Dezember 1965.
22a. Ähnliches ereignet sich auch anläßlich der „Reichstagung des
Grenzbüchereidienstes" im Juni 1938 oder im Verlauf der 12. Tagung des
„Internationalen Verlegerkongresses“ , Leipzig 19. - 24. Juni 1938. Es ist das eine
genau gezielte, vor allem aber eine Gemeinschaftsaktion der von Hans
Hagemeyer in Personalunion geleiteten „Reichsstelle" und des „Amtes für
Schrifttumspflege (stellvertretender Leiter ist der Germanist Hellmuth
Langenbucher), das zeitweise rund 1400 Lektoren beschäftigt. Diese Lektoren
sind beauftragt, den gesamten Buch- und Zeitschriftenmarkt „nach politischen,
weltanschaulichen und volkserzieherischen Gesichtspunkten" zu sichten. Zur
Information des Buchhandels und der Schulen gibt es die Zeitschrift
„Bücherkunde", worin Neuerscheinungen nach den angeführten Kriterien
rezensiert werden.
23. Adolf Bartels: Geschichte der deutschen Literatur, 16.Aufi., Braunschweig-
Berlin-Leipzig-Hamburg: Georg Westermann 1937, IX.
24. Mitgeteilt von Sándor Hartwich, Wien 15. Mai 1969.
25. Rudolf Putzien: Nostradamus, München: Drei Eichen 1960, 178.
25a. Milan Dubrovic: Veruntreute Geschichte. Die Wiener Salons und
Literatencafés, Wien-Hamburg: Paul Zsolnay 1985, 265.
26. Mitgeteilt von Eduard Hebra, Salzburg, am 11.August 1956.
27. Eduard Hebra, ebenda.
28. Mitgeteilt vom Gemeindesekretär, St Wolfgang, am 10.IX.1959: Archiv Dr.Rocek.
29. Alexander Lernet-Holenia: Ein Traum in Rot, a.a.O.,257ft.
29a. Kriminalfilm der Carl Froelich-Filmproduktion GmbH.Darsteller: Adolf
Wohlbrück, Marieluise Claudius, Sibylle Schmitz, Eugen Klöpfer, Hilde
Hildebrand u.a. Drehbuch: Thea v. Harbou und R.A. Stemmle, Regie: Carl
Froelich. Uraufführing: 17.10.1935, Hamburg. Details über Alexander Lernet-
Holenia's Abreise verdanke ich Milan Dubrovic, der mit Alexander Lernet-Holenia
und Charlotte Sweceny in Berlin weilte.
30. Mitgeteilt von Annie Lifezis, Bad Vöslau, am 6.Juli 1979.
31. Alexander Lemet-Holenia: Die Inseln unter dem Winde. Frankfurt am Main: S.
Fischer 1952, 201 ff; die bisher angeführten Daten der Reiseroute sind ebenso
den Poststempeln von Briefen an Frau Charlotte Sweceny entnommen wie die
noch folgenden. Leider gewährte die Adressatin keinen Einblick in die
umfangreichen Korrespondenzen, die daher seit ihrem Tod als verloren gelten
müssen. Sie las jedoch einige Stellen daraus vor, die in den Text eingearbeitet
wurden. Mitschrift Oktober 1955: Archiv Dr. Rocek.
32. Mitgeteilt von Annie Lifezis, Bad Vöslau, am 6. Juli 1979. Details über die
Kreuzfahrt in die Karibik verdanke ich Frau Charlotte Sweceny. Einzelheiten über
diese wie auch über die folgenden Monate erfuhr ich ferner in einem Gespräch,
das ich mit Albrecht Joseph unter Beisein von Eva Lernet und Anna Mahler am
6.12.1977 in Wien führte. Anwesend war auch meine Frau Johanna, der ich nicht
genug dafür danken kann, daß sie damals wie in fast allen einschlägigen
Gesprächen Schlagwörter mitstenographierte. Vgl. dazu auch: Albrecht Joseph,
Aufzeichnungen über Alexander Lemet-Holenia, Xeroxkopie des Typoskriptes:
Archiv Dr. Rocek.
33. Mitgeteilt von Eduard Hebra, Salzburg, am S. Oktober 1956.
34. Alexander Lernet-Holenia: Glastüren. Berlin: S.Fischer 1939.
35. Red. Beitrag: Liebe unter den Wassem. In: Das schwarze Korps, 5. Jänner 1939,
36. Alexander Lernet-Holenia: Stahlenheim. Berlin: S.Fischer 1938, 175.
37. Vgl.zum Ganzen: Sigmund Graff: Von S.M. zu N.S. Erinnerungen eines
Bühnenautors (1900 - 1945), München-Wels: Welsermühl 1963,208.
38. Red. Beitrag: Das kommt vor! Österreicher, hinter Glastüren. In: Völkischer
Beobachter. W.A., 26. Februar 1939
39. NS Kulturgemeinde, Kulturpolitisches Archiv an die Filmkontingentstelle, z.H.
von Frau Matthes, Berlin 12.1I.1935.
40. Amt Kulturpolitisches Archiv an Deutsches Volksbildungswerk, 18. April 1942.
41. Elke Fröhlich (Hrsg): Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche
Fragmente, Bd.3. München-New York-London-Paris: K.G.Saur 1987, 583.
42. Mitgeteilt von Alexander Lernet-Holenia, Wien, am 8. November 1967.
43. Die Dame. Berlin: Deutscher Verlag. Chefredakteur: Ludwig
Reindl(Brunnthal/Obb. 16.2.1890 - Konstanz 4.6.1983); Redakteur: Paul Wiegler
(Frankfurt/M. 15.9.1878 -Berlin 22.8.1949).
44. Alexander Lernet-Holenia: Mars im Widder. Stockholm: Bermann-Fischer 1947,
163 f.
45. Vgl.dazu: „Geschäftsverteilungsplan der Abteilung Inland im Oberkommando
der Wehrmacht, 27.Juni 1939".
46. Mitgeteilt von Alexander Lemet-Holenia, am 12. März 1969; damit
übereinstimmend die Aussage von Sándor Hartwich, Anmerkung 24.
47. OKW, Abteilung Inland, Gruppe III.
48. Vorabdruck in: Die Dame. Berlin: Deutscher Verlag 1940, Nr.22, 33ff bis 1941,
Nr.3, 37 f .
49. Mitgeteilt von Charlotte Sweceny, April 1955.
50. Titelseite (Alexander Lernet-Holenia: Mars im Widder. Roman. S.Fischer
Verlag/Berlin. Im Mittelfeld Stempel der Zensurstelle: Freigegeben vom
Oberkommando der Wehrmacht, Abteilung Inland III, Berlin, den 29.4.1941.
Scheidt) und Impressum (Ausstattung G.Ruth. Erste bis fünfzehnte Auflage 1941,
Copyright 1941 by S. Fischer Verlag, Berlin, alle Rechte vorbehalten. Printed in
Germany) Xeroxkopien: Archiv Dr. Rocek.
51. Günther Ziegler, General Leutnant (Deutsch Lissa/Breslau 9.2.1892 - seit
20.7.1945 in russischer Kriegsgefangenschaft); 15.11.1913
Flugzeugführerprüfung; 1914 als Einjährig Freiwilliger zur Reserve der
Fliegertruppe übergetreten; 1915 Leutnant Jagdstaffel 26; 1921 Dr.rer.pol. in
Freiburg i.Br.; 1922 „Rheinische Kreditbank"; 1922 - 1924 Firma „Dyckerhoff und
Söhne“ in Amoensburg/Rh; 1924 – 1926 „Sportflug G.m.b.H. Berlin"; 1927 - 1930
„Deutsche Verkehrsflugschule Berlin“; 1930 - 1931 „Argus Motoren Werke
Berlin"; 1931 Beitritt zur NSDAP; Hauptamtlicher Referent im Stab der obersten
SA Führung; stellvertretender Führer des nationalsozialistischen Fliegerkorps;
Mitglied des Reichtages in 6. Und 8. Wahlperiode, 1934 Major der Luftwaffe;
1938 Oberst; 1938 bis 1941 Chef der Abteilung Inland im OKW; 1941 General
Major.
52. Mitgeteilt von Sándor Hartwich, Wien, am 15,Mai 1969; damit übereinstimmend
die Anmerkungen von Charlotte Sweceny, April 1955.
53. Vgl.dazu die Anmerkungen 20 und 34; Alexander Lemet-Holenia: Ollapotrida.
Bühnenmanuskript. Berlin: S. Fischer 1926. Erster öffentlicher Druck in: Joachim
Schondorft (Hrsg): Österreichisches Theater des XX. Inhrhunderts. München:
Langen-Müller 1961, 327.
54. Mitgeteilt von Eduard Hebra, Salzburg, am 11. August 1956.