Mars im Widder (1941)
Roman
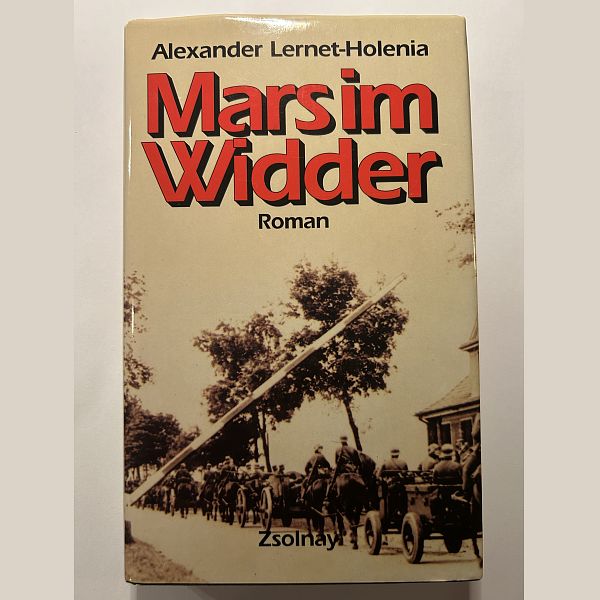
Lernet im Mars
Nachwort In: Mars im Widder: Zsolnay, Wien, 1976, S. 261-268.
Otto F. Beer
Habent sua fata libelli" würde der Oberfähnrich Rosthorn sagen. Alexander Lernet-Holenias Mars im Widder konnte von Anfang an nicht über einen Mangel an "fatum" klagen, wurde von seinem Schicksal bereits ereilt, als das Buch noch nicht einmal das erste Schaufenster erreicht hatte. Dies geschah im Jahr 1941, als die Erstauflage zwar ausgedruckt war, aber noch vor der Auslieferung verboten wurde. Aber vielleicht müßte man die abenteuerliche Geschichte dieses Buches zurückverfolgen bis zu dem Zeitpunkt, da es zwar noch keinen Mars im Widder gab, aber der Autor selbst Mars dienen mußte.
Denn nicht nur Wallmoden hatte im August 1939 eine Waffenübung zu absolvieren, sondern auch Alexander Lernet-Holenia. Er war in den Tagen der österreichisch-ungarischen Armee Offizier gewesen - nun holte man ihn wieder zu den Waffen. Zwar gab es nicht mehr die alte k. u. k. Kavallerie, das Zeitalter der Panzerarmeen und der Luftkämpfe war angebrochen. Immerhin, im Staub polnischer Straßen und später in den Schlammwüsten Rußlands, spielten die Pferde noch eine bedeutende Rolle. Lernet-Holenia hat den Polenfeldzug mitgemacht und dabei eifrig Tagebuch geführt. Später gelang es dem Ullstein-Verlag, ihn nach dem Ende des Feldzugs UK (Unabkömmlichstellung) stellen zu lassen. Diesem unerwarteten Zivilistendasein mitten im Kriege verdankt Mars im Widder sein Dasein.
Zwischen dem 15. Dezember 1939 und dem 15. Februar 1940 - in nicht mehr als zwei Monaten mithin - ist der Roman entstanden. Lernet-Holenia bekennt, daß er für die Schilderung des Aufmarsches an Deutschlands Ostgrenze, der Angriffe auf Polen, des Sieges über den couragierten Widerstand seiner Verteidiger seine Kriegstagebücher ausgiebig verwendet hat. Wer das Buch mit militärischem Auge liest, wird darüber nicht erstaunt sein. Kein Autor würde bloß aus der Phantasie heraus Details dieser Art erfinden: wie eine bestimmte Straßenkreuzung gesichert, ein Dorf gestürmt, eine gegnerische Einheit aufgerieben wird. Lernet-Holenia versichert, daß alles Strategische und Taktische in diesem Buch stimmt, daß sich die Operationen tatsächlich so entwickelt haben, wie sie hier dargestellt werden. Es "stimmen" auch die Menschen: der lateinisch zitierende Rosthorn, die Kameraden Wallmodens - sie alle hatten lebende Vorbilder. "Roman" oder neuhochdeutsch "fiction" - waren die Liebesgeschichte, die Intrige, die Visionen, der Einbruch von etwas Überwirklichem in die Wirklichkeit, der transzendentale oder phantastische Zug an diesem Geschehen.
So also entstand die Geschichte von der Liebe zu einer bis zuletzt Unbekannten, die vielleicht eine Schwindlerin war, weit wahrscheinlicher aber mit der österreichischen Widerstandsbewegung Kontakt hatte und sich deshalb Paß und Existenz jener Baronin Pistohlkors aneignete, der wir am Ende des Buches in Person begegnen.
Daß Menschen in die Existenz anderer schlüpfen, daß sie deren Leben - womöglich mit deren Dokumenten - weiterleben oder weiterzuleben gezwungen sind: dies ist ja ein vertrautes Element in der Erzählkunst Lernet-Holenias; wir begegnen diesem Motiv unter anderem auch in seinem gleichfalls in Kriegsjahren entstandenen Roman Beide Sizilien. Auch die Ahnung eines Jenseitigen, eines Totenreiches ist seit seinem Baron Bagge ein vertrautes Kunstmittel.
Dichtung und Wahrheit also in einem: so wurde Mars im Widder dem deutschen Leser präsentiert als eine sehr eigenwillige, sehr persönliche sehr Lernetsche Interpretation eines Krieges, der damals allerdings noch mit Kavalleristen-Elan in wehrlose Länder vorgetragen wurde, die dem Angriff kaum ernsten Widerstand entgegensetzen konnten. Besagte Leser mußten allerdings zur Dame greifen, um diese Geschichte in Fortsetzungen verfolgen zu können. Hinter diesem mondänen Titel verbarg sich nämlich eine Zeitschrift, deren erlesener literarischer oder ganz allgemein ästhetischer Geschmack mit heutigem Illustriertenmaßstab nicht zu messen ist. Lernet-Holenia war dort mehrmals zu Wort gekommen - es war durchaus logisch, daß auch sein Roman vom Polenfeldzug in diesem Ullstein-Blatt abgedruckt wurde. Gelesen haben ihn allerdings nicht nur Damen. Auch Soldaten, denen die herkömmlichen Propagandaschilderungen nicht zusagten, fanden hier ein weit wahreres, weil menschlicheres Bild der Kämpfe im Osten. Leider lasen ihn aber auch jene Soldaten, die an besagtem Propagandaklischee persönlich mitwirkten. Sie runzelten vorläufig nur die Stirn, aber sie schwiegen nicht auf Dauer. Der Abdruck in Fortsetzungen immerhin konnnte unbehindert zu Ende gehen.
Inzwischen wurde die Buchausgabe vorbereitet vom arisierten S. Fischer-Verlag, der seltsamerweise auch im Dritten Reich das jüdische "S." für "Samuel" nicht abgelegt hatte. Im Frühjahr 1941 waren in Leipzig 15.000 Exemplare ausgedruckt worden - zu Kriegszeiten eine respektable Erstauflage! Damals gab es einen Fliegergeneral, der die Verbindung zwischen Wehrmacht und Propagandaministerium herzustellen hatte. Auf sein Betreiben hin führte das "Pro-Mi" seinen Schlag gegen das Buch, das so gar nicht in jenes Leitbild vom deutschen Soldaten paßte, das man im Dritten Reich hochzuhalten liebte. So wurde die ganze Auflage verboten und durfte nicht ausgeliefert werden. Der Verleger befolgte Goebbels Anweisung derart gründlich, daß er dem Autor nicht einmal die ihm zustehenden 20 Freiexemplare aushändigte. Hätte Lernet-Holenia nicht noch aus den Tagen der Vorbereitung des Buchs ein Fahnenexemplar für sich behalten - sein ganzes Werk wäre für immer verloren gewesen. Zwar legte das Haus S. Fischer die komplett ausgedruckten 15.000 Exemplare in den Keller,
wohl in der Hoffnung, nach dem "Endsieg" werde man in Berlin großzügiger denken und den Verkauf gestatten.
Aber nicht nur aus dem Endsieg wurde nichts, sondern die gesamte Auflage erlebte das Kriegsende nicht. Bei den Angriffen auf Leipzig im Winter 1943/44 ging das ganze Lager in Flammen auf - von Mars im Widder blieb kein einziges Exemplar übrig. Als der Krieg zu Ende war, stand vermutlich Mars nicht mehr im Widder, und der Autor hatte es wieder mit den rechtmäßigen Inhabern seines alten Verlages zu tun. Das Haus Bermann-Fischer wollte in Stockholm das Buch herausbringen. Das gerettete Fahnenexemplar lieferte die Unterlage für die nun tatsächliche Erstausgabe. Sie erschien 1947, allerdings in einer wesentlich kleineren Auflage, als das Leipziger Haus sechs Jahre zuvor geplant hatte. Ein guter Teil jener deutschsprachigen Literatur, die damals in Ländern mit Edelvaluta wie Schweden, Holland oder der Schweiz aufgelegt wurde, erschien ja aus Devisengründen beinahe unter Ausschluß der deutschen Öffentlichkeit. Noch gab es keine D-Mark, man konnte die Bücher zwar in beschränktem Maß nach Österreich, beinahe aber gar nicht nach Deutschland liefern.
Nun aber, da das Buch immerhin vorlag, durfte man sich den Kopf darüber zerbrechen, was darin seinerzeit den Grimm der deutschen Propaganda herausgefordert hatte. War es die Schilderung eines geheimen deutschen Aufmarsches an der Ostgrenze lange vor Ausbruch jener Feindseligkeiten, die doch angeblich durch generische Gewaltakte ausgelöst worden waren? Die systematische Vorbereitung eines Überfalls also? Ach, es war noch viel mehr herauszulesen: der Respekt vor einem Feind, der nur deshalb überrumpelt werden konnte, weil er nicht oder nur ungenügend mobilisiert hatte; dann dessen mutiges Ausharren auf einem offensichtlich verlorenen Posten, das Elend der Flucht - dies alles paßte nicht zum Feindbild des "ostischen Untermenschen".
Wallmodens Beziehung zum Reich des Todes, das visionäre Überschreiten einer Grenze zur Wirklichkeit ist natürlich gleichfalls ein Zug, der nicht ins Wunschbild der deutschen Kriegspropaganda gepaßt hatte, aber dies war fast schon ein zu feines Mittel, als daß es den Gegner ernstlich erregt hätte. Wenn Karl Kraus einmal behauptet hat, ein Witz, den der Zensor verstehe, werde mit Recht verboten, so läßt sich dieses Aperçu nur auf die eher kryptischen Teile von Mars im Widder anwenden. Zu ihnen gehört vor allem der berühmte Zug der Krebse. Diese Schilderung ist ein literarisches Kabinettstück und hat damals unter Leuten, die zwischen den Zeilen zu lesen verstanden, ungeheures Aufsehen erregt.
Vielleicht fehlt uns heute bereits das Organ für jene Kunst der Anspielung, die sich zu Zeiten der Diktatur entwickelt hat. Möglicherweise wird der Leser von heute auch nicht aufs erste verstehen, daß der Kreis um den geheimnisvollen Herrn Örtel, den Empfänger von Geheimbotschaften, aus Österreichern bestand, denen das Dritte Reich gegen den Strich ging und die sich in verborgenen Konventikeln organisierten. Jene Krebse aber, die eines Nachts unbeirrbar über eine Heerstraße marschieren, wurden damals sehr wohl als Symbol der großen Panzerarmeen begriffen, die ihrem Untergang blind entgegengingen. Sie "wanderten von Osten nach Westen", "rasselnd und klirrend wie ein Geschwader von Gerüsteten". Rosthorn würde sagen: "Sapieti sat!" - und so steht denn auch die apokalyptische Konsequenz aus diesem ebenso sinnlosen wie unaufhaltsamen Zug konsequenterweise in lateinischer Sprache.
Lernet-Holenia hat solche Bilder des großen Unterganges in jenen Jahren gern beschworen, und er tat es nicht weniger chiffriert als zu gleicher Zeit Ernst Jünger. In seinem Mann im Hut von 1937 zeichnete er das Bild des großen Nibelungenzuges nach Osten, bei dem nur Hagen von Tronje ganz genau weiß, daß keiner der Heerfahrer von Attilas Hof lebend zurückkehren wird. Und als der Krieg zu Ende war, hat er mit Germanien eine dichterische Endabrechnung mit der großen Götterdämmerung und ihrem Todestrieb gehalten. Das Kernstück dieser Auseinandersetzung aber bleibt Mars im Widder, der so viele Umwege nehmen mußte, um als literarisches Dokument endlich zugänglich zu sein.
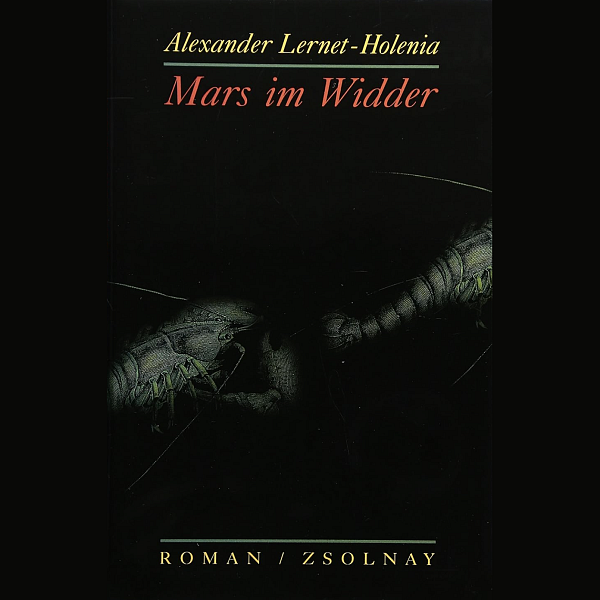
Günther Fischer schreibt in "Der Spiegel"
11.11.1997
Visionen des Untergangs
Die Wiederauflage einer von den Nazis verbotenen gepenstischen Parabel des Polenfeldzugs erinnert an den österreichischen Schriftsteller Alexander Lernet-Holenia, der Zeit seines Lebens selbstbewußt rückwärtsgewandt und lustvoll renitent blieb.
Verschobene Realitäten, Geschichten hinter den Geschichten und Träume waren die Leitthemen des 1976 verstorbenen österreichischen Schriftstellers Alexander Lernet-Holenia. Der zu seinem 100. Geburtstag wiederveröffentlichte Roman "Mars im Widder" gehört mit "Der Mann im Hut" (1937), "Ein Traum in Rot" (1939) und "Die Inseln unter dem Winde" (1952) zu seinen Hauptwerken. Er folgt wie die anderen Romane phantastisch-surrealen Erzählmustern. Dennoch war die Geschichte so nahe an der Realität, daß das Buch 1941 noch vor der Auslieferung an den Buchhandel von Propagandaminister Joseph Goebbels verboten wurde.
Lernet-Holenia erzählt vom österreichischen Reserveoffizier Wallmoden, der im September 1939 die Wiener Gesellschaft verläßt, um an der "soldatischen Übung", wie der Polenfeldzug anfangs verharmlosend umschrieben wird, teilzunehmen. Die "Übung" erweist sich als rücksichtsloser Vernichtungskrieg. Willenlos läßt sich Wallmoden treiben, verfolgt wie im Traum die Ereignisse, die er selbst mitgestaltet. Visionen des Untergangs verfolgen ihn, ein gespenstisch-irrealer, nächtlicher Zug von scheinbar gefühllosen Wanderkrebsen wird zum grauenhaften Sinnbild für die deutsche Armee.
Nichts findet sich in diesem 1939/40 geschriebenen Buch vom heroischen Soldatenbild der Nazis, in den Schilderungen der Panzer- und Luftkämpfe nichts vom angeblichen Verteidigungskrieg. Der Angriffskrieg der Deutschen wird als solcher auch dargestellt. Mit einfachen Sätzen verdichtet Lernet-Holenia sein düsteres Zeitgemälde zu einer unheimlichen Vision des Untergangs der Deutschen.
Über 50 Romane schrieb er insgesamt, an Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal orientierte Theaterstücke, Lyrik- und Essaybände. Es ist ein voluminöses, meist elegant formuliertes, doch unterschiedlich gewichtiges Oeuvre, das er vorlegte. Daß sein Name kaum noch jemanden ein Begriff ist, liegt wohl an der Thematik: Der bedeutende, größere Teil seines Gesamtwerks ist die elegisch-herrische Nachfeier der untergegangenen Donaumonarchie.
Selbstbewußt rückwärtsgewandt war auch die Lebensart des oft als "letzter Österreicher" gefeierten Vielfachpreisträgers (1926 bekam er den renommierten Kleist-Preis, 1961 den Großen Österreichischen Staatspreis): Nach dem Krieg nahm er in der leerstehenden Wiener Hofburg seinen Wohnsitz, in einem Brief an den damaligen österreichischen Kulturminister nannte er Stücke von Edward Albee und Peter Handke "niederträchtig schlecht", empfahl Subventionsentzug für die Wiener Theater, die diese Stücke aufführten. Und aus Protest gegen die Nobelpreisverleihung an Heinrich Böll, den er beschuldigte, "die deutsche Literatur auf die östlichen Steppen zu verschleppen", legte er 1972 den Vorsitz des Österreichischen Pen-Clubs nieder.
So bieten Schriftsteller und sein Werk nicht allzuviele Identifikationsmöglichkeiten für heutige Leser. Seine Theaterstücke müssen am Ende des 20. Jahrhunderts neu auf ihre Bühnen- und Thementauglichkeit überprüft werden. Meisterwerke wie "Mars im Widder" haben aber nicht von ihrer Gültigkeit verloren.