Prinz Eugen (1960)
Biographie
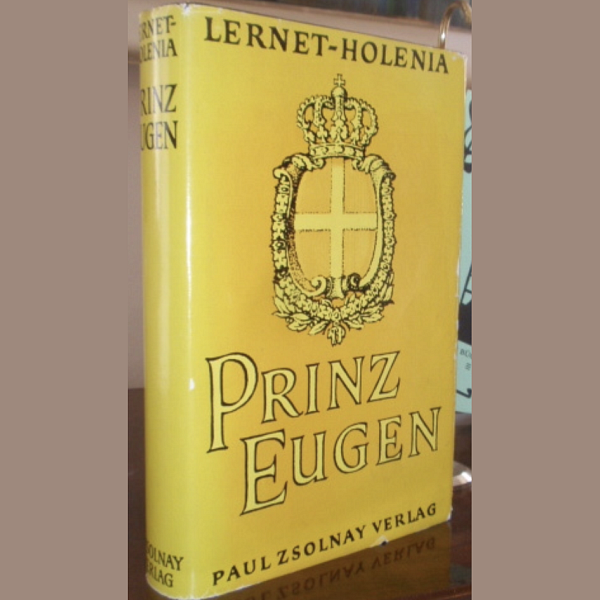
Erschienen in Der Spiegel 43/1960 am 18.10.1960.
Mutige Knaben
Auch ein gutes und ganzes Viertel des Bluts«, schrieb der österreichische Schriftsteller Alexander Lernet -Holenia über seinen neuesten Roman -Helden, »das Eugen so oft auf den Schlachtfeldern zwischen Höchstädt und Belgrad, zwischen Turin und Malplaquet verspritzen sollte, war dieses sizilianische, ein weiteres Viertel das mancinische, gleichfalls nicht unverdächtige Erbe; und wenn es auch zu weit ginge zu sagen, daß seine Größe nur aus den im Vergleich zu seinen fürstlichen Quartieren so obskuren Gegenden der Mazzarinis und Ruffalinis, der Mancinis und Capoccis gekommen sei, so bleibt dennoch zu vermuten, daß ...«
Der für Lernet-Holenia typische Bandwurmsatz geht noch weiter. Sein Inhalt ist die Behauptung, jene umständlich aufgezählte und etwas verdächtige Blutmischung habe den savoyischen Prinzen Eugen (1663 bis 1736) zum berühmten Helden gemacht. Bei der Ahnenforschung in eigener Sache war der zuweilen in Wien, zuweilen in St. Wolfgang wohnende Lernet-Holenia - der Literarhistoriker Fritz Martini bestätigt ihm »virtuose Bühnenstücke und mondäne Erzählungen« - auf die Figur des »edlen Ritters« gestoßen.«
Für Lernet-Holenia, der die Gerüchte nicht dementiert, von erlauchter, wenn auch illegitimer Herkunft zu sein, bedeutet die Ahnenforschung mehr als eine Feierabendbeschäftigung. Sie hat sich bei ihm zu einer Arbeit ausgewachsen, deren Abfallprodukte seiner schriftstellerischen Aktivität zugute kommen. Lernet-Holenia: »Immer tiefer ward ich durch die bezüglichen Dokumente in die Vorzeit hinabgeführt, und die Geschichte meiner eigenen Herkunft fand ich auf das seltsamste mit der Vergangenheit des Reiches verwoben.«
Für Lernet-Holenias Projekt, aus den Schnitzeln und Spänen seiner Ahnenforschung eine Biographie Eugens von Savoyen zu verfassen, gewährte ihm der Insel-Verlag sogleich eine Anzahlung, und bereits im Dezember 1957 druckte das »Forum« - Untertitel: »Österreichische Monatsblätter für Kulturelle Freiheit« - die »Vorrede zu einem Prinzen Eugen« ab. Schon in dieser Vorrede, noch mehr aber in den folgenden abgedruckten Arbeitsproben wurde deutlich, daß der heute 62jährige Schriftsteller nicht gewillt war, eine historische Biographie im herkömmlichen Sinne zu schreiben. Das »Nebenprodukt« seiner Ahnenforschung sollte bewußt im Gegensatz stehen zu jener klassischen Geschichtsschreibung, die »alles nur durch die persönliche Professorenbrille gesehen hat«.
Sagt der Urösterreicher in der saloppen Einführung zu seinem großangelegten Geschichtswerk: »Diese Darstellung ... ist gleichsam nur das Nebenprodukt der Untersuchung eines weit geringfügigeren Gegenstandes. Beim Studium der zweiten Belagerung Wiens durch die Türken war ich nämlich auf die Erwähnung eines Offiziers meines eigenen Namens gestoßen.«
Dieses Vorhaben, nämlich eine historische Biographie unkonventionell, ironisch und mit ständigem Bezug auf die Gegenwart zu schreiben - als Vorbild diente Voltaires »Histoire de Charles XII« -, ist in der Tat so elegant gelungen, daß der Insel-Verlag vor einer Veröffentlichung zurückschreckte. Der österreichische Verlag Paul Zsolnay hatte weniger Hemmungen; er wird das teils sehr persönliche, teils dem Wortlaut der Quellen folgende Werk noch im Herbst dieses Jahres herausbringen.*
Das eigene ausgeprägte genealogische Interesse - er entdeckte in seiner mutmaßlichen Ahnenkette ein »Übermaß toter Hauptleute« - hat Lernet -Holenia als eine Art Barriere auch vor seine Eugen-Biographie gestellt. Erst wer sich durch das Familiengestrüpp der Mancinis, Carignans und Mazzarinis geschlagen hat, darf erfahren, daß Eugen, am 18. Oktober 1663 im »Hôtel de Soissons« zu Paris geboren, ganz und gar verdächtige Eltern hatte: Graf von Soissons, der mögliche Vater, sei gedankenlos, etwas beschränkt, aber gutaussehend und die Mutter Olympia eine »notorische Intrigantin« und »Giftmischerin« gewesen. Zudem hätten die beiden Schwestern des »Retters des Abendlandes« ein skandalöses Leben geführt, »indem sie dem Trunk und der Prostitution verfielen«.
Den dunkelsten Punkt in Eugens Leben konnte freilich auch Lernet-Holenia, wiewohl er schier unermeßliches Quellenmaterial studiert haben muß, nicht erhellen. Die Frage, ob sein Held nun der natürliche Sohn Ludwigs XIV. war - Mutter Olympia war eine Mätresse des Sonnenkönigs -, muß Lernet -Holenia auch am Ende seiner akribischen Detektiv-Forschungen offenlassen.
Doch spricht, nach seiner Auffassung, Eugens Leben »für die Legende«. Eugen habe sozusagen den Mythos des Herakles und Ödipus fortgesetzt. »Wie die jüngsten Söhne in den Märchen und Mythen floh Eugen ins Ausland, wand sich Lorbeeren ums Haupt, ward berühmt, kehrte an der Spitze der kaiserlichen Armeen in seine Heimat zurück, besiegte seinen sei's nun wirklichen, sei's auch bloß mutmaßlichen Vater.«
Dem Vergleich mit berühmten Helden und Feldherren hält Eugen auch in anderer Hinsicht stand; er soll homosexuell - Spitznamen: »Madame Simone« und »Madame l'Ancienne« - gewesen sein. Schränkt Lernet-Holenia ein: »Vielleicht war er bloß seelisch homosexuell.« Jedenfalls stellt Lernet-Holenia den »mutigen Knaben« Eugen neben den Schwedenkönig Karl XII. (1682 bis 1718) und den Preußen Friedrich den Großen (1712 bis 1786), die dem gleichen Verdacht ausgesetzt sind, und resumiert: »Offensichtlich waren diese drei großen Heerführer, körperlich, eben wirklich bloß von Schlachten träumenden Knaben gleich, und um so größere Helden waren sie im Kriege, als sie bei Frauen keinerlei Erfolge zu erringen vermochten.«
In der Tat ist in Eugens Biographie zwar häufig vom Karneval, doch nie von Frauen die Rede. Zum Ersatz war sein Leben seit dem Tag, an dem er vor Ofen wahrscheinlich »die erste der vielen glorreich empfangenen Wunden« erhielt, bis hin zu der Türkenschlacht bei Belgrad 1717, wo er zum letzten und dreizehnten Male verwundet wurde, ganz und gar mit kriegerischen Kämpfen und Siegen ausgefüllt.
Kein Wunder, daß also die Schilderung der vielen Heldentaten, »durch die Eugen recht eigentlich unsterblich geworden ist«, den meisten Raum in Lernet-Holenias Biographie beansprucht. Die Schlachten gegen die Türken etwa werden so detailliert dargestellt, als sei Lernet-Holenia des glorreichen Prinzen Kriegsberichterstatter gewesen. Mit liebevoller Ironie schildert Lernet-Holenia zum Beispiel die Bekleidung der Soldaten über mehrere Buchseiten hinweg; bei der Beschreibung der Schlachten ist weder der Stand der Sonne noch das Verhalten der Pferde vergessen.
Nichtsdestoweniger sind dem neuesten Eugen-Biographen auch der Charakter und Lebenssinn seines Helden des Forschens wert. Daß der Charakter Eugens »viel jugendlicher und jungenhafter, um nicht zu sagen, infantiler gewesen sein muß, als man gemeinhin glauben sollte«, leitet Lernet-Holenia von Scherzen ab, die sich Eugen auch bei den ernstesten Gelegenheiten einfallen ließ.
Auch die großen Schlachten, so meint der Schriftsteller, habe der von Statur schmächtige Eugen »gar nicht eigentlich wie ein überlegter Mann, sondern weit eher wie ein mutiger Knabe geschlagen«. Dabei habe er freilich seinen knabenhaften Ebenbildern - etwa Karl XII. von Schweden, der 1718 bei der Belagerung von Frederikshall umkam - ein Mehr an Geist vorausgehabt: Eugen verlor »überhaupt keine Schlacht, da er, als er in die Jahre kam, wo er keine mehr schlagen konnte, auch keine mehr schlug«.
Allerdings hatte Eugen, als er »in die Jahre kam«, das »zur Bedeutungslosigkeit zurückgesunkene« Reich der habsburgischen Kaiser wieder aufgerichtet, hatte die Hausmacht seiner Herren verdreifacht, kurz: Er war zum Gründer einer neuen Großmacht geworden. Durch seine Siege waren die Türken aus Ungarn vertrieben worden, Bayern, Oberitalien und die Niederlande gehörten zu seiner Kriegsbeute. Der Grund des Erfolgs, laut Lernet -Holenia: »Daß auch Eugen einem Mythos folgte ..., dem Mythos des Helden, der nicht weiß, von wem er stammt, und der sich selbst beruft.«
Auch dieser Mythos hatte freilich seine Tragik, die Lernet-Holenia in dem lapidaren Satz zusammenfaßt: »Doch lebte er zu lange.« Am 21. April 1736 endlich fand ein Kammerdiener den »außerordentlichen Mann, der an Größe kaum von einem Alexander, an Ruhm vielleicht von einem Caesar und nur an Unglück von einem Hannibal übertroffen worden war«, tot im Bett.
Sein Lebenswerk sollte - ähnlich dem Hannibals, der ein Weltreich erobert und wieder verloren habe - weniger dauerhaft sein als sein Ruhm. Klagt Lernet -Holenia: »Jetzt ist das Reich, in welchem vorzeiten die Sonne nicht unterging, wieder ein so kleines Land geworden wie im Spätmittelalter, und an die sieben Millionen Menschen leben auf seinem Gebiet. Es ist, als ob Zwerge in den Überresten eines von Riesen erbauten Palastes hausten.«
Etwa in dieser Art sind die Anspielungen und Anklagen formuliert, mit denen Lernet-Holenia die Biographie seines Helden zur Nutzanwendung für den Leser von 1960 schmückt. Bevorzugtes Ziel der Klage sind der Adel, die Generalität und die Soldaten der Gegenwart.
»Eigentlicher Adel kann immer nur sogenannte noblesse d'épée, Kriegs- und Blutadel sein«, behauptet der Kleist-Preisträger Lernet-Holenia (er erhielt den Preis 1927 für sein Drama »Österreichische Komödie") und preist das siebzehnte Jahrhundert; wo »allein in Frankreich 31 000 Edelleute im Zweikampf gefallen« seien. Da der Adel den »Todeswillen« im gleichen Maße verloren, habe wie das Bürgertum den »Lebenswillen«, muß Lernet-Holenia betrübt feststellen: »So wird denn heutzutage die Aristokratie in Österreich ihr Leben ebensowenig mutwillig aufs Spiel setzen, wie die Frau eines Industriellen ihre Gestalt riskieren wird, um ihre Familie über Gebühr fortzupflanzen.«
Keiner der späteren, geschweige denn der heutigen Feldherren kann, nach Lernet-Holenia, einen Vergleich mit dem Prinzen Eugen aushalten. Denn: »Zur Zeit der Türkenkriege ... dienten die Generale noch dem genauen Gegenteile dessen, was sie späterhin verursachen sollten, nämlich nicht dem Schaden, sondern dem Nutzen des Heeres ...« Weil sie sich selbst an die Spitze der Truppe setzten, begeisterten sie auch die Soldaten, glaubt Lernet-Holenia, »wohingegen die Soldaten beider Weltkriege von dem Bewußtsein, daß sich ihre Befehlshaber auf ihre Kosten schonten, nur um so weniger veranlaßt wurden, sich für sie zu opfern«.
Quasi geschützt von dem ruhmreichen Rücken Eugens, polemisiert Geschichtsschreiber Lernet-Holenia gegen die moderne Kriegführung. Ein Vergiftungsattentat auf den berühmten Savoyer etwa bringt ihn auf den Gedanken, die künftigen Kriege doch nicht mit Waffen, sondern durch Attentate zu führen, da ein Giftmord gewiß billiger sei als ein Feldzug.
Gleichzeitig muß Lernet-Holenia allerdings einräumen: »Doch stehen ja allen unmittelbaren Lösungen auf dem Gebiete des Krieges die Generale, die sich vorher noch mit Ruhm bedecken, die Heereslieferanten, welche zuvor tüchtig verdienen, und selbst die meisten einfachen Soldaten im Wege, die vor ihrem Tode wenigstens noch auf eine Zeit der Belanglosigkeit ihres bürgerlichen Lebens, der Langeweile ihrer Ehen und vor allem der Traurigkeit entfliehen wollen, die jeden Menschen vor sich selbst ergreift.«
Dagegen verteidigt Lernet-Holenia seinen Helden energisch gegen eine Geschichtsschreibung, die in Eugen einen besonders erfolgreichen Vertreter des Pangermanismus oder des sogenannten Abendlandes sehen möchte: Die »Ostraumpolitik« Eugens sei »ausschließlich eine Erfindung nach Deutschland schielender österreichischer Geschichtsprofessoren«, schreibt Ahnenforscher Lernet -Holenia; in Eugens Kopf habe weder ein sogenannter Reichsgedanke noch ein abendländisches Konzept existiert, und übrigens habe Eugen nicht einmal richtig Deutsch sprechen können: »Von Eugens Weltanschauung ist uns lediglich überliefert, daß er weder sonderlich religiös war noch daß er von der österreichischen Hofkamarilla etwas hielt.«
Um so mehr hielt der von seinem Biographen Lernet-Holenia »Genius«, »Held« oder »Knabe« genannte Eugen vom Kriegführen. Und der Krieg, das gibt sogar Lernet-Holenia zu, war auch damals schon ein Geschäft. Prinz Eugen von Savoyen, der Kaiserliche Generalleutnant und Reichsfeldmarschall, Generalkapitän der Niederlande, Präsident des Hofkriegsrates und Staats- und Konferenzminister, starb als einer der reichsten Männer Europas. Er hinterließ die »für damalige Verhältnisse ungeheure Summe von fünfundzwanzig Millionen«.